Düsseldorf/Hengersberg - Wenn es etwas zu erben gibt, kassiert der Staat häufig mit. Er fordert Steuern. Die Übertragung von Vermögen schon zu Lebzeiten kann diese Abgabe verringern. Eine Möglichkeit, das zu tun, geht über das Niessbrauchrecht. Fragen und Antworten zu dieser Strategie.
Was bedeutet Niessbrauch?
Hinter dem Begriff Niessbrauch steckt die Idee, dass eine Eigentümerin Vermögen an jemanden überträgt, während die umfassende Nutzung des Vermögens bei ihr verbleibt: So können Niessbrauchnehmer zum Beispiel weiterhin das übertragene Eigenheim bewohnen, Miete der übertragenen Mietwohnung kassieren oder mit der Dividende eines schon zu Lebzeiten weitergegebenen Wertpapierdepots die Rente aufbessern.
Der Niessbrauch wird in der Regel auf Lebenszeit vereinbart und im Kontext einer vorweggenommenen Erbfolge als Schenkung vorbehalten. Im Prinzip ist Niessbrauch damit nichts anderes als eine an eine Gegenleistung gebundene Schenkung.
Worauf kann Niessbrauch angewendet werden?
Am bekanntesten ist es bei Immobilien. Der Klassiker ist das Eigenheim: Eltern schenken es ihren Kindern und lassen sich dafür lebenslanges Niessbrauchsrecht einräumen.
Unternehmer können aber auch ihren Betrieb und Geschäftsanteile unter Vorbehalt eines Niessbrauchrechts frühzeitig an Nachfolger übergeben. Die Verantwortung für die Firma liegt dann bei ihnen, während der Alteigentümer von der sogenannten Fruchtziehung profitiert. Etwa in Form einer regelmässigen Gewinnausschüttung.
Kunstsammlungen, Oldtimer, Schmuck oder wertvollen Hausrat können Erblasser ebenfalls vorweg verteilen. "Ein Niessbrauch kann an Sachen, übertragenen Rechten und sogar am gesamten Vermögen begründet werden", sagt Notarin Nina Bomhard aus dem bayerischen Hengersberg.
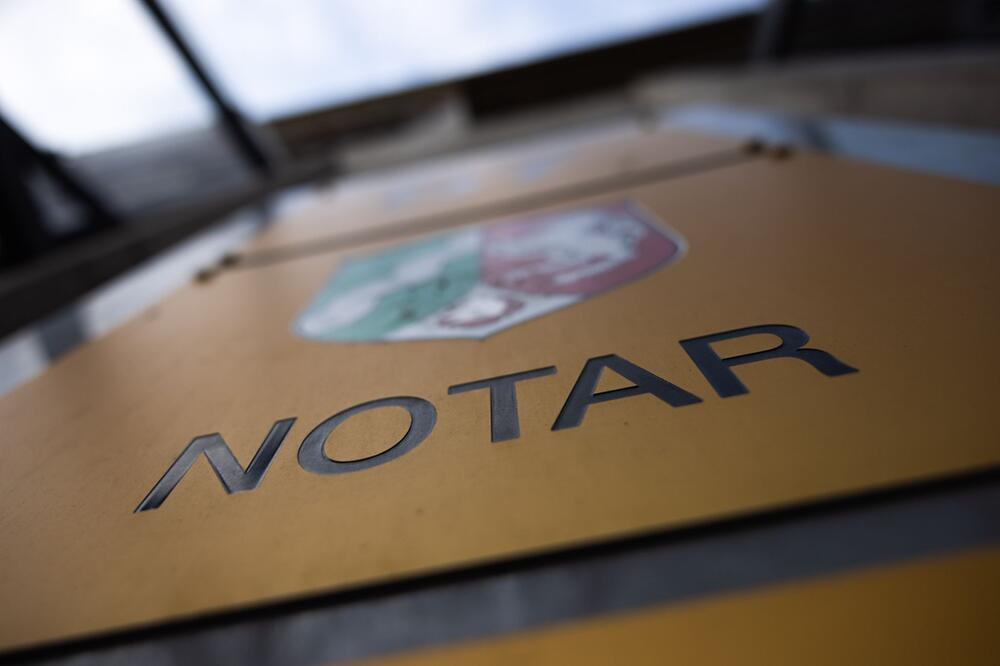
Für wen lohnt es sich, über Niessbrauch nachzudenken?
"Niessbrauch ist ein gern genutztes Instrument der vorweggenommenen Erbfolge", erläutert Bomhard. So sinnvoll es sein kann, Vermögensnachfolge frühzeitig zu regeln, sollten Schenker nicht nur sorgfältig überlegen, wie sie sich absichern möchten, sondern auch Zeitpunkt und Umfang der Übertragung bedenken.
Ein wichtiger Ausgangspunkt sind die schenkungsrechtlichen Freibeträge. Sie variieren je nach Verhältnis zwischen Schenker und den zu Beschenkenden. Unter Ehepartnern beträgt der Freibetrag 500.000 Euro alle zehn Jahre, gegenüber Kindern 400.000 Euro. Erst wenn verschenktes Vermögen die Freibeträge überschreitet, fordert der Staat vom Beschenkten Steuern. Wer die Freibeträge mit seinem Vermögen also überschreitet, kann darüber nachdenken, vorzeitig etwas davon weiterzugeben. Das hilft Erben in spe, die Belastung durch Erbschaftsteuer zu verringern.
Und wie funktioniert der Steuerabzug?
Wer Vermögen wie Haus und Betrieb überlässt, kann sich über den Niessbrauch bereits angesprochene Nutzungsrechte vorbehalten. Der oder die Beschenkte ist damit nicht von der Schenkungsteuer befreit. Weil aber Niessbrauchrechte auf dem Vermögen lasten, "mindern sie den Wert der Schenkung und damit die Steuer", erläutert Rechtsanwalt Marc Jülicher von der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge (DVEV).
Wie hoch der Wert des jeweiligen Niessbrauchrechts anzusetzen ist, richtet sich auch nach dem Alter des Schenkenden. Vererbt dieser sein Vermögen schon mit Mitte 40, ist der Niessbrauchwert deutlich höher als wenn er es erst mit Mitte 80 weiterreicht. Dann ist seine restliche Lebenserwartung deutlich geringer und der Niessbrauchzeitraum überschaubar. Beschenkte müssen dann mehr Schenkungsteuer berappen.
Wann sollte eine Übertragung stattfinden?
Die Antwort von Jülicher ist eindeutig: "Je früher, desto attraktiver die Schenkung." Wer mit 60 Jahren ein Mietshaus im Niessbrauchmodell überträgt, hilft künftigen Erben etwa 40 Prozent des schenkungsteuerlich relevanten Werts abzusetzen. Etwa 30 Prozent sind es, wenn erst mit 75 Jahren übertragen wird, wie Jülicher vorrechnet. Im optimalen Fall zahlen Beschenkte gar keine Steuer: Erhält ein Kind etwa ein Haus von den Eltern im Wert von 600.000 Euro, werden zunächst 400.000 Euro Freibetrag abgezogen. Wiegt der Niessbrauch durch die vorgezogene Schenkung die übrigen 200.000 Euro auf, ist das ein Nullsummenspiel, Schenkungsteuer wird dann nicht fällig.
Solche Berechnungen fussen zum einen auf dem Jahreswert des Niessbrauchs. Das sind zum Beispiel die Jahresmiete einer Eigentumswohnung oder die jährlichen Erträge eines Wertpapierdepots. Zum anderen werden Sterbetafeln und ein sogenannter Vervielfältiger herangezogen, den der Fiskus für lebenslange Nutzungen und Leistungen ansetzt. Die Daten ergeben sich aus statistischen Lebenserwartungen und werden daher Jahr für Jahr angepasst.
Wie wird der Niessbrauch vereinbart?
Bei beweglichen Sachen wie Auto, Schmuck und Kunst reichen Nina Bomhard zufolge schon eine Einigung zwischen Schenker und Beschenktem, auch mündlich, und Übergabe. Trotzdem rät sie, aus Beweisgründen eine schriftliche Abmachung zu treffen.
Bei Immobilien verlangt das Gesetz die Einigung in grundbuchtauglicher Form und die Eintragung des Niessbrauchs ins Grundbuch. Beschenkter und Nutzniesser müssen also einen Notar oder eine Notarin einbinden.
Empfehlungen der Redaktion
Rentiert sich Niessbrauch in jedem Fall?
Nein. Aufgrund der komplexen Berechnungen kommt es nach Jülichers Erfahrung selten vor, dass der Steuervorteil komplett ausgeschöpft werden kann. Zu Bedenken ist auch: Bei der Berechnung der Schenkungsteuer unter Berücksichtigung des Niessbrauchs geht das Finanzamt davon aus, dass der Niessbrauchnehmer tatsächlich das Alter der statistischen Lebenserwartung erreicht. Verstirbt er kurz nach Vereinbarung eines Niessbrauchs, ist auch der Steuervorteil dahin.
Gerade bei Menschen mit hohen Vermögen, die schon in jüngeren Jahren Teile davon übertragen wollen, kann sich die Vereinbarung eines Niessbrauchs aber allemal rentieren. © Deutsche Presse-Agentur
