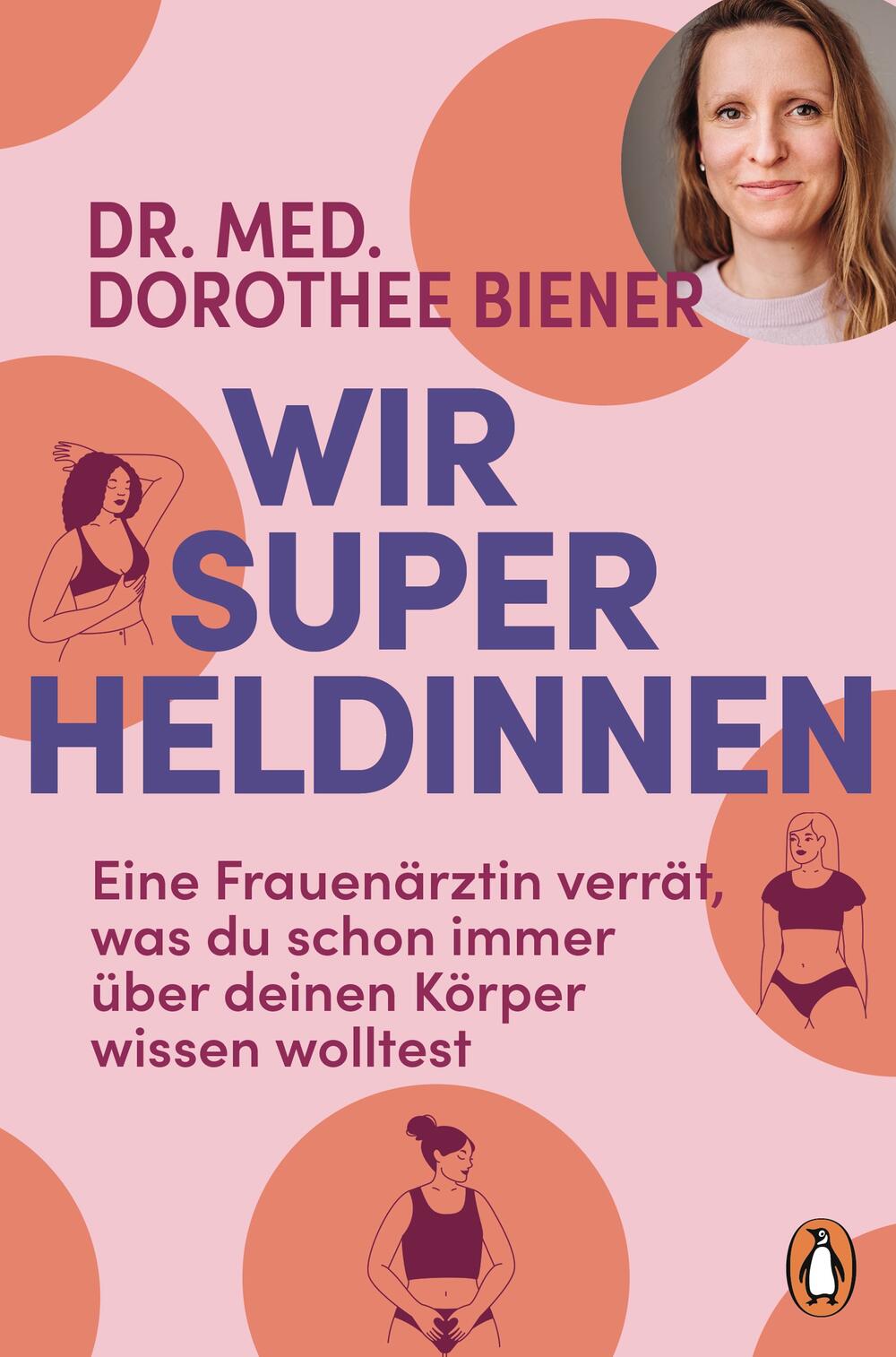Auf dem Weg zur Gleichberechtigung auch in der medizinischen Versorgung hat sich schon viel getan – es gibt aber auch noch viel zu tun, sagt die Gynäkologin Dorothee Biener. Im Interview über ihr Buch "Wir Superheldinnen" erklärt sie, wo wir mit Blick auf geschlechtsspezifische Medizin stehen. Ausserdem räumt sie mit Mythen rund um Periodenschmerzen und den vaginalen Orgasmus auf.
Wo stehen wir hierzulande im Jahr 2025, wenn es um das Bewusstsein für Frauengesundheit geht?
Dorothee Biener: Es ist toll, als Frau in dieser Zeit und nicht vor 300 oder 500 Jahren zu leben. Nichtsdestotrotz sind wir noch lange nicht dort, wo wir eigentlich hinwollen. Denn von einer Gleichberechtigung in der Gesundheitsversorgung sind wir auch 2025 weit entfernt. Zwar gibt es mittlerweile ein Verständnis dafür, dass wir geschlechtsspezifische Medizin brauchen, dennoch herrscht noch jede Menge Luft nach oben. Ich denke da etwa an die Versorgung mit Schmerzmitteln unter der Geburt: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Medizin diesbezüglich alle Probleme gelöst hätte, wenn Männer Kinder gebären würden. Stattdessen durchleben Frauen im Kreisssaal häufig Situationen, die ich aus medizinischer Perspektive als inadäquat behandelt bezeichnen würde.
Es gibt also noch viel zu tun.
So ist es. Es muss auch viel getan werden, um bestimmte Frauenerkrankungen besser verstehen zu können, die schlichtweg eine viel kleinere Lobby haben. Insofern muss das Bewusstsein entsprechend gestärkt werden – nicht nur in der Forschung oder Medizin, sondern auch bei den Frauen selbst. Denn ihr Körper hat ganz andere Bedürfnisse als der eines männlichen Patienten. Es gilt also, Beschwerden wahrzunehmen und auch zu verbalisieren. Sätze wie "Diese Schmerzen gehören zum Frausein dazu und müssen ausgehalten werden" sollten aus dem gesellschaftlichen Mindset verschwinden.
Lesen Sie auch
Denn während vermutlich jede Frau in ihrem Leben schon einmal mit dieser Äusserung konfrontiert wurde, glaube ich nicht, dass Männer im medizinischen Kontext eine solche Reaktion erfahren. Insofern liegt mir mit Blick auf Frauengesundheit das Thema Selbstfürsorge sehr am Herzen. Denn indem wir Frauen die Verantwortung für unseren Körper übernehmen, stehen wir für ihn und unsere Bedürfnisse ein.
In Ihrem Buch "Wir Superheldinnen" widmen Sie sich dem weiblichen Körper. Soll der Titel Frauen daran erinnern, wie stark ihr Körper ist?
Ganz genau. Nicht nur aus gynäkologischer Perspektive finde ich Frauengesundheit und -körper wahnsinnig spannend und faszinierend. Wir Frauen neigen häufig dazu, unsere Grösse, Masse, Haarfarbe und viele weitere Körpermerkmale so sehr zu hinterfragen, dass wir dabei völlig vergessen, wie fantastisch wir und unsere Körper eigentlich sind. Darauf sollten wir unbedingt stolz sein und entsprechend wichtig war es mir, diesen Appell bereits im Titel zu transportieren.
Warum stehen Frauen ihrem Körper häufig gar nicht so wohlwollend gegenüber?
Ich glaube, unser Körperbild hat viel mit unserer Erziehung und Sozialisation zu tun. Kleine Kinder etwa haben ein absolutes Urvertrauen in ihren Körper. Doch genau dieses Urvertrauen scheint Mädchen und Frauen im Laufe der Jahre abhandenzukommen, anders als bei Jungen und Männern. Denn ein weiblicher Körper wird schnell von der Gesellschaft beurteilt und bewertet – das macht natürlich etwas mit den Betroffenen.
"Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gar keine Zeit haben, für Gleichberechtigung einzustehen, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, Cremes gegen Cellulite zu kaufen."
Einen weiteren Grund sehe ich im Markt und Konsum. Vom Überangebot diverser Kosmetikprodukte bis hin zu Möglichkeiten, operative Eingriffe durchführen zu lassen. Hier sprechen wir von einer riesigen Maschinerie. Weil sie gesellschaftlich beobachtet und bewertet werden, sind Frauen häufig entsprechend bereit, etwas an sich zu verändern oder machen zu lassen. Hier kommen die sozialen Medien ins Spiel: Denn verschiedene Beauty-Accounts und -Filter reden Frauen gewissermassen ein, nicht schön und gut genug zu sein. Es mag etwas überspitzt klingen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir gar keine Zeit haben, für Gleichberechtigung einzustehen, weil wir viel zu sehr damit beschäftigt sind, Cremes gegen Cellulite zu kaufen. (lacht) Wir sprechen somit von einer Gemengelage, aus der wir uns selbst befreien müssen.
In Ihrem Buch widmen Sie sich unter anderem hartnäckigen Mythen rund um den weiblichen Körper – welche Mythen begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit als Gynäkologin am häufigsten?
Häufig begegnet mir der Mythos "Nur ein perfekter Körper macht glücklich". Aber was ist eigentlich dieser propagierte perfekte Körper? Immerhin wird dieser von einer Person oder Personen im Aussen definiert, was mich sehr traurig macht – auch, weil sich unter diesem Mythos viele ähnliche Mythen subsumieren. Damit meine ich etwa Glaubenssätze wie "Guten Sex hat nur, wer gut aussieht" oder "Wenn ich mir meine Labien nicht operativ korrigieren lasse, kann ich keinen guten Sex haben".
Dazu kommen beispielsweise Mythen über die weibliche Erregung oder über den klitoralen und vaginalen Orgasmus. Dabei gibt es keinen vaginalen Orgasmus – es hat nie einen gegeben. Dennoch hält sich dieser Mythos mit einer enormen Vehemenz und lässt Frauen glauben, mit ihnen stimme etwas nicht, wenn sie keinen vaginalen Orgasmus erleben. Auch der Satz "Periodenschmerzen sind normal" ist ein typischer Mythos. Denn: Starke Periodenschmerzen sind nicht normal. Kurzum: All diese Mythen halten Frauen klein und gestehen ihnen nicht den Raum zu, den sie eigentlich verdient haben.
Müssten wir nicht viel aufgeklärter sein, um besagten Mythen eben keine Plattform mehr zu geben?
Ich glaube, dass fast jede Frau Zweifel bezüglich ihres Körpers in sich trägt. Denn das propagierte Schönheitsideal ist schier omnipräsent und nur die wenigsten Frauen lassen dieses nicht an sich heran. Zudem muss man sich die Frage stellen, ob wir gesamtgesellschaftlich wirklich so aufgeklärt sind, wie wir immer behaupten. Meiner Meinung nach haben wir bezüglich der Aufklärung ein grosses Wissensdefizit. Ich kann mich auch selbst von diesem Defizit nicht ausnehmen: Während der Buchrecherche habe ich festgestellt, dass ich manche Dinge beispielsweise über die weibliche Anatomie nicht weiss. Im Rahmen meines Studiums wurde die Klitoris etwa nie behandelt. Dabei handelt es sich um ein fantastisches Organ, das ausschliesslich für unser Lustempfinden da ist. Insofern denke ich, dass wir längst nicht so aufgeklärt sind, wie wir es sein sollten.
Und das, obwohl wir im Zeitalter des Internets leben, in dem wir nonstop Zugang zu Informationsquellen haben.
Das stimmt. Umso wichtiger ist es hier, zwischen guten Informationen und Falschinformationen zu unterscheiden. Indem gewisse Portale oder auch persönliche Erfahrungsberichte nicht immer richtige Informationen verbreiten, werden bei Betroffenen schnell Ängste geschürt. Dabei ist hier die korrekte Einordnung von Informationen wahnsinnig wichtig – aus diesem Grund studieren immer noch Menschen Medizin, die auch von Internetinformationen nicht einfach ersetzt werden können. Meiner Meinung nach sollten Frauen ausserdem untereinander viel mehr erlebtes Wissen austauschen und weitergeben. Leider gibt es hier noch immer viel zu viele Tabuthemen. So wissen die wenigsten Frauen, die ich kenne, beispielsweise, ob ihre Grossmutter eine Fehlgeburt erleben musste oder wie sie ihre Wechseljahre erlebt hat. Das Transportieren gelebten Wissens kommt häufig zu kurz.
Bleiben wir bei Tabuthemen. Mit Blick auf den weiblichen Körper gibt es viele Körperteile oder Vorgänge im Körper, die tabuisiert werden. Wie können wir uns gesellschaftlich von der Scham lösen?
Von Periodenscham über die Menopause bis hin zu Fehlgeburten oder Inkontinenz – vieles ist schambehaftet. Sich davon zu lösen, ist nicht ganz einfach. Einen ersten, wichtigen Schritt gehen wir, indem wir uns wertvolles Wissen aneignen. Je mehr wir also beispielsweise über Inkontinenz wissen, umso besser können wir einordnen, was normal ist und was man bei möglichen Beschwerden tun kann.
"Wir haben in unserer jugendwahnigen Gesellschaft verlernt, von der älteren Generation zu lernen."
Empfehlungen der Redaktion
Neben dem Wissen spielt dann noch Erfahrung eine grosse Rolle bei der Enttabuisierung. Wir haben in unserer jugendwahnigen Gesellschaft verlernt, von der älteren Generation zu lernen. Dazu kommt eine häufig mangelnde Kommunikation: Wir sollten viel mehr mit Freundinnen, Schwestern oder Tanten über unsere Körper sprechen, um Ängste abzubauen und eine positive Kommunikation aufzubauen. Insofern wünsche ich mir, dass Frauen viel wertschätzender zu sich und ihrem Körper sind und genau dieses Bewusstsein auch weitergeben.
Empfinden Frauen mit Blick auf die Tabuisierung der Menopause einen entsprechenden Leidensdruck beim Älterwerden?
Häufig ist das so, ja. Dabei ist das natürlich absolut unnötig. Der Blick auf Gesellschaften und Kulturen, in denen das Alter wertgeschätzt wird, zeigt uns, dass die Frauen dort häufig an deutlich geringeren Menopausenbeschwerden leiden. Gehen mit der Menopause Beschwerden und Symptome einher, sollten diese unbedingt behandelt werden, keine Frage. Trotzdem wird um die Menopause herum eine grosse Angst geschürt – dabei ist sie ein Teil des weiblichen Lebens. Mit Eintreten der Perimenopause, also dem Übergang in die natürlichen Wechseljahre, stellen die meisten Frauen bereits Veränderungen und andere Fähigkeiten an sich fest. Weil sie nicht mehr so östrogengeflutet sind, werden sie unabhängiger von bestimmten Äusserlichkeiten und stehen stärker für sich ein. Dass das nicht allen Menschen in ihrem Umfeld gleichermassen recht ist, dürfte an dieser Stelle wohl klar sein. (lacht)
Über die Gesprächspartnerin
- Dr. med. Dorothee Biener ist promovierte Frauenärztin und Diplom-Biologin. Als Ärztin arbeitet sie seit vielen Jahren in der Gynäkologie in Krankenhaus und Praxis, als Biologin forschte sie am Mammakarzinom und an der Genverteilung im Zellkern. 2025 ist ihr Sachbuch "Wir Superheldinnen" erschienen.