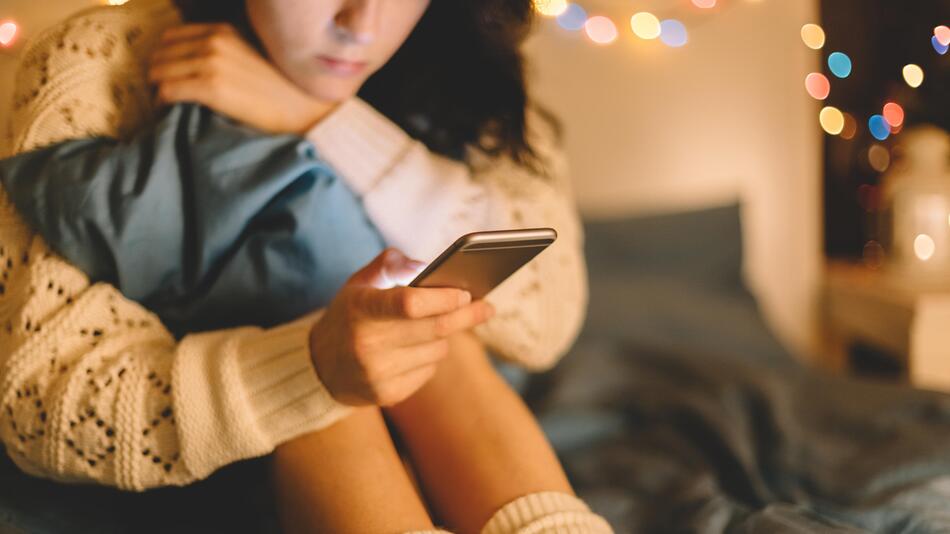Sie sind rund um die Uhr erreichbar, anonym und urteilsfrei: Die Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge leisten emotionale Erste Hilfe. Doch was passiert eigentlich, wenn jemand dort anruft? Zwei erfahrene Helfer gewähren einen Einblick in eine stille, aber essenzielle Stütze unserer Gesellschaft.
Sicher ist er Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, bereits aufgefallen: Der Hinweis am Ende unserer Artikeln, in denen es um Suizid geht:
Hilfsangebote
- Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Suizid-Gedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge unter der Telefonnummer 0800/1110-111 (Deutschland), 142 (Österreich), 143 (Schweiz).
- Anlaufstellen für verschiedene Krisensituationen im Überblick finden Sie hier.
Wir weisen darin auf die Nummer der Telefonseelsorge hin. Sie ist für Menschen in der Krise oft die letzte Anlaufstelle, bevor jemand vielleicht für immer verstummt. Aber wer nimmt dort eigentlich den Hörer ab?
Nicola und Birgit wissen es genau. Beide engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge. Sie haben in dieser Zeit unzählige Gespräche geführt, zugehört und mitgefühlt. Im Gespräch berichten sie von ihrer Arbeit und von dem, was sie täglich hinterlässt.
Wer sich bei der Telefonseelsorge engagiert
Nicola ist seit zehn Jahren dabei, Birgit seit 2010. Beide kamen über den Wunsch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, zur Telefonseelsorge – und über die Überraschung, dass es gar nicht so einfach ist, dort mitzumachen. "Ich dachte, ich rufe da an, und dann geht's los. Die müssen doch froh sein, wenn sich jemand meldet", erinnert sich Birgit. Stattdessen erlebte sie ein strukturiertes Bewerbungsverfahren: ein Infoabend, eine ausführliche Bewerbungsmappe, ein ganztägiger Kennenlern-Workshop und danach eine zweijährige Ausbildung mit Selbsterfahrung, Gruppenarbeit und vielen Rollenspielen.
"Man merkt schon in der Ausbildung, dass sich da was verschiebt. Man kommuniziert anders, hört genauer hin."
"Wenn das so schwierig ist, da reinzukommen, dann will ich das erst recht", sagt sie über ihre anfänglichen Gedanken. Dieser Ehrgeiz wurde zum Antrieb, aber auch zur Basis für ein Engagement, das sie über die Jahre selbst verändert hat. "Man merkt schon in der Ausbildung, dass sich da was verschiebt. Man kommuniziert anders, hört genauer hin."
Auch Nicola erinnert sich an diesen Prozess. Als Personaler war er überzeugt, "gut mit Menschen umgehen zu können", doch bei der Telefonseelsorge lernte er, sich zurückzunehmen. "Ich war überrascht, wie viel ich über mich selbst erfahren habe. Das hat mir beruflich, aber auch privat geholfen."
Über die Telefonseelsorge
- Die Telefonseelsorge bietet allen Menschen Unterstützung, die einsam sind, trauern, in einer Lebenskrise stecken oder Suizidgedanken haben. Sie ist rund um die Uhr telefonisch, per Mail, Chat und in über 20 Städten auch persönlich erreichbar.
- Bundesweit gibt es über 100 regionale Telefonseelsorge-Stellen. Dort arbeiten rund 300 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie etwa 7.700 ausgebildete Ehrenamtliche.
Ein Ehrenamt mit Tiefe
Die Ehrenamtlichen arbeiten etwa 15 Stunden pro Monat, verteilt auf Dienste am Telefon, im Chat oder per Mail. Hinzu kommen verpflichtende Fortbildungen, regelmässige Supervisionstreffen sowie zehn Nachtdienste pro Jahr.
Die eigentliche Arbeit findet konzentriert in den Räumen der Telefonseelsorge statt. Wo sich diese befinden, wissen nur die Mitarbeitenden, zum Schutz ihrer Privatsphäre. Von zuhause werden die Anrufe nicht beantwortet. "Diese räumliche Trennung hilft enorm", sagt Birgit. "Wenn ich nach einem anstrengenden Gespräch die Bürotür hinter mir zumache und dann noch eine halbe Stunde nach Hause fahre, komme ich auch innerlich wieder im hier und jetzt an."
"Am Anfang habe ich die Mails mit auf die Couch genommen. Das geht nicht."
Im Gegensatz dazu findet die Mailberatung meist von zu Hause statt. Gerade dort, so Birgit, sei die emotionale Abgrenzung schwieriger. "Am Anfang habe ich die Mails mit auf die Couch genommen. Das geht nicht. Man muss lernen, auch da Grenzen zu setzen."
Ein typischer Dienst und doch immer anders
Ein Schichtbeginn startet oft mit der Übergabe. Wer geht, berichtet, ob es wiederkehrende Anrufe gab, ob jemand in akuter Krise ist. Dann beginnt der Dienst – mit Headset, allein in einem der Beratungsräume. Und mit dem Wissen: Sobald ein Gespräch endet, könnte schon das nächste warten.
"Man muss sich aktiv ausklinken, um kurz durchzuatmen oder auf die Toilette zu gehen", sagt Birgit. Der nächste Anrufer warte bereits, sobald man ein Gespräch beendet. Die einzige etwas ruhigere Zeit ist Birgit und Nicola zufolge zwischen drei und fünf Uhr früh.
Was die Menschen wirklich bewegt
Die Gründe, warum sich Menschen an die Telefonseelsorge wenden, sind vielfältig und oft zutiefst menschlich. "Einsamkeit ist eines der grössten Themen", sagt Nicola. "Und das nicht nur bei Menschen ohne soziales Umfeld. Viele fühlen sich auch trotz Partnerschaften und Freunden einsam."
Hinzu kommen Ängste, Panikattacken, depressive Verstimmungen, suizidale Gedanken. Der Alltag bringt viele Ratsuchende aus dem Gleichgewicht: Prüfungsangst, familiäre Konflikte, Trauer, Erkrankungen, finanzielle Sorgen. Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen ist nach dem subjektiven Empfinden der beiden Helfer seit der Corona-Pandemie gestiegen. Laut interner Auswertung geben aktuell 34 Prozent der Anrufenden an, eine psychische oder psychiatrische Diagnose zu haben.
"Da ist etwas mit den Menschen passiert", sagt Birgit. Die Isolation, der Kontrollverlust, das Zerbrechen von Strukturen: Viele dieser Effekte würden sich in den Gesprächen spiegeln.
Zuhören statt urteilen
Die Telefonseelsorge versteht sich nicht als Krisenintervention im therapeutischen Sinne. "Wir geben keine Ratschläge", betont Nicola. "Wir hören zu. Wir halten aus. Wir spiegeln zurück. Und wir fragen nach Gefühlen."
Wenn eine Anruferin vom Tod ihres Mannes berichtet, spricht Birgit nicht über medizinische Hintergründe, sondern fragt: "Macht Sie das auch wütend?" – oft mit überraschendem Effekt. "Dann sagen Menschen: 'Ja, aber das kann ich doch niemandem sagen. Ich bin doch nicht wütend auf meinen Mann, der gestorben ist.'" Darauf antwortet sie dann: "Doch, das dürfen sie sein."
Solche Sätze, solche Erkenntnisse sind oft der stille Erfolg einer Beratung. "Wenn jemand sagt: 'Das hat mir jetzt gutgetan', das bedeutet schon viel", erzählt Nicola.
Zwischen Empathie und Überforderung
Die Gespräche sind nicht immer leicht und auch nicht immer versöhnlich. "Manchmal merke ich, dass ich nicht mehr bei der Person bin", sagt Nicola. "Dann spreche ich das offen an. Und wenn nötig, beende ich das Gespräch."
Besonders schwierig werde es, wenn Menschen diskriminierende oder menschenfeindliche Aussagen machen. "Ich lasse mich nicht instrumentalisieren, damit jemand sich bestätigt fühlt in seinem Hass", betont Birgit. Auch da hilft die Ausbildung: "Wir bringen alle unsere Biografien mit. Aber wir lernen, was wir aushalten können und wo unsere Grenzen sind."
Wenn jede Sekunde zählt
Akute Suizidfälle sind selten, aber auch die gibt es. Nicola erinnert sich an eine junge Frau, die Medikamente genommen hatte und in Panik geriet. "Sie war kaum verständlich, stockte, weinte. Ich hatte das Gefühl: Sie will doch leben, sie braucht nur Hilfe, diesen Moment zu überstehen."
"Ich habe mit zitternden Fingern den Notruf gewählt."
Nicola blieb am Telefon, versuchte, ruhig zu bleiben. "Ich habe mit zitternden Fingern den Notruf gewählt." Am Ende kam die Rettung und die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. "Solche Momente sind selten. Aber sie bleiben. Und sie motivieren einen."
Auch Birgit hatte solche Erlebnisse. "Einmal hat mir eine Frau am Ende des Gesprächs gesagt: 'Heute Nacht hatte ich das Gefühl, ein Engel hat seine Flügel um mich gelegt.' Das hat mich tief berührt. Ich wusste: Ich habe sie vielleicht in genau der richtigen Nacht begleitet."
Nähe, Distanz und Langzeitkontakte
Jeder Kommunikationskanal bringt eigene Dynamiken mit sich. Während es am Telefon und im Chat oft anonyme Konversationen gibt, entstehen über die Mailberatung langfristigere Kontakte. Die Gespräche via Mail bringen laut den beiden Ehrenamtlichen auch eine persönlichere Bindung mit sich.
"Ich habe eine junge Frau, mit der ich seit über zwei Jahren schreibe", erzählt Birgit. "Das ist fast wie eine Brieffreundschaft. Sie ist psychisch sehr belastet, und ich begleite sie durch viele Phasen: Beruf, Therapie, Alltag."
Solche Beziehungen bringen Nähe mit sich und erfordern deshalb auch immer wieder bewusste Abgrenzung. "Man fragt dann schon mal, wie der erste Arbeitstag war", sagt Birgit. "Das ist nicht unprofessionell, das ist menschlich."
Was erlaubt ist – und was nicht
Auch wenn manche Anrufe dramatisch klingen, rechtlich ist der Handlungsspielraum begrenzt. "Wir wissen nicht, wer anruft. Keine Telefonnummer, keine Adresse. Das ist unser Schutz und auch der der Anrufenden", sagt Birgit.
"Die Anonymität ist unser Markenzeichen und damit auch unsere Grenze."
Nur wenn jemand freiwillig persönliche Daten nennt und explizit zustimmt, darf ein Notruf ausgelöst werden. Schweigepflicht gilt immer, auch gegenüber Polizei oder Staatsanwaltschaft. Nur in extremen Fällen und über mehrere Instanzen könnte eine Rückverfolgung versucht werden. "Die Anonymität ist unser Markenzeichen und damit auch unsere Grenze", erklärt Nicola.
Was bleibt und was sich verändert
Die intensive Auseinandersetzung mit existenziellen Krisen verändert die eigene Haltung zum Leben. "Ich bin dankbarer geworden", sagt Birgit. "Dankbar für das, was ich habe. Für meine Familie, meine Gesundheit. Nichts davon ist selbstverständlich."
Auch ihre Sicht auf andere Menschen habe sich gewandelt. "Ich bin vorsichtiger mit Urteilen geworden. Jeder Mensch bringt einen Rucksack mit, den wir nicht sehen."
Empfehlungen der Redaktion
Nicola spricht von einer Sinnhaftigkeit, die er gefunden hat. "Ich bin kein Gutmensch. Aber ich habe gelernt, mich selbst mehr anzunehmen. Und dadurch auch anderen offener zu begegnen."
Was sich beide wünschen? "Weniger Besserwisserei", sagt Birgit. "Wenn jemand ein Problem hat, muss nicht gleich ein Ratschlag kommen. Zuhören hilft oft mehr."
Nicola bringt es anders auf den Punkt: "Sich selbst lieben lernen. Dann kann man auch andere lieben."
Verwendete Quellen
- Gespräch mit Birgit und Nicola
- TelefonSeelsorge.de: Über uns