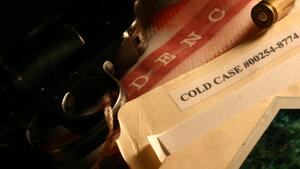Der Mord an Meredith Kercher im italienischen Perugia machte Amanda Knox 2007 zur Hauptfigur eines Justizdramas. Der Fall zeigt, wie Schwächen im Rechtssystem und eine sensationslüsterne Boulevardpresse aus einer jungen Frau ein vermeintliches Monster formen können.
Die Stadt Perugia, mit ihren engen Gassen und altehrwürdigen Gebäuden, wirkt wie die perfekte italienische Postkartenidylle. Im November 2007 verwandelte sich das beschauliche Universitätsstädtchen jedoch zum Zentrum eines internationalen Medienspektakels: Der Mord an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher entfachte einen Justizkrimi, der sich über fast ein Jahrzehnt und durch alle Instanzen zog – und Amanda Knox weltweit als "Engel mit den Eisaugen" bekannt machte.
Was ist 2007 in Perugia geschehen?
Die Carabinieri finden am 2. November 2007 in der Via della Pergola 7, Perugia, ein grausames Bild vor. Die britische Austauschstudentin Meredith Kercher, 21, liegt halb entkleidet auf ihrem Bett – vergewaltigt, beraubt und erstochen. Der Gerichtsmediziner wird laut "Welt" später über 40 Messerstiche an ihrem Körper zählen.
Meredith Kercher studierte an der Ausländer-Universität in Perugia. Die Wohnung teilte sie sich mit drei anderen Studentinnen, unter ihnen die 20-jährige Amanda Knox, einer amerikanischen Austauschstudentin aus Seattle. Knox ist es, die am Morgen des 2. November die Polizei ruft.
Gemeinsam mit ihrem neuen Freund, dem 23-jährigen Informatikstudenten Raffaele Sollecito, hatte sie die Tote aufgefunden. Sie erzählt den Beamten zunächst, dass sie die Nacht bei Sollecito verbracht habe. Erst am Morgen sei sie in die Wohnung zurückgekehrt.
Doch die Ermittelnden haben Zweifel an Knox‘ und Sollecitos Alibi. Ihre Aussagen passen nicht zusammen, ihr Verhalten – Knox macht Dehnübungen auf dem Polizeirevier – wirkt auf die Ermittelnden verdächtig. Noch am selben Tag nehmen die italienischen Ermittler die beiden ins Visier.
Die Spuren am Tatort
Während Knox und Sollecito verhört werden, läuft die Spurensicherung auf Hochtouren. Die Ermittelnden finden blutige Fingerabdrücke, DNA-Material an Kerchers Kleidung und Sperma in ihrem Körper. Die Spuren können Rudy G., einem 20-jährigen Drogen-Kriminellen aus Perugia, zugeordnet werden. Es besteht kein Zweifel: Er war am Tatort. Echte biologische Spuren, die Knox und Sollecito mit dem Verbrechen in Zusammenhang bringen, gibt es nicht.
G. flieht nach Deutschland, wo er rund zwei Wochen nach dem Tod von Meredith Kercher laut "Stern" festgenommen und nach Italien überstellt wird. Bei seinen Vernehmungen räumt er ein, Sex mit Kercher gehabt zu haben – bestreitet aber, für den Tod der britischen Studentin verantwortlich zu sein.
Stattdessen belastet er Knox und Sollecito schwer: Zwischen den Mitbewohnerinnen sei es an jenem Abend zum Streit gekommen. Als er daraufhin Kerchers Zimmer betrat, habe sich Sollecito gerade über den blutenden Körper Kerchers gebeugt.
Im Oktober 2008 wird G. zu 16 Jahren Haft verurteilt – allerdings nur wegen sexueller Nötigung und Beihilfe zum Mord, nicht als Haupttäter. Das Gericht sieht ihn als Komplizen von Knox und Sollecito.
"Engel mit den Eisaugen" – die mediale Dämonisierung
Am 16. Januar 2009 wird der Prozess gegen das Paar eröffnet. Nach Ansicht der Anklage waren Knox und Sollecito auf der Suche nach "extremen Erfahrungen". Die Staatsanwaltschaft präsentiert die Theorie von einem "sexuellen Spiel", das ausser Kontrolle geraten war. Von einem "satanischen Ritus" und "dämonischen Motiven" ist die Rede.
Die italienische Boulevardpresse konstruiert das Bild einer kaltblütigen Manipulatorin, die ihren Charme einsetzt, um italienische Männer zu verführen und zu kontrollieren. "Engel mit den Eisaugen", der Teufel in Frauengestalt – Knox wird zur Projektionsfläche für Frauenhass.
Alte Fotos aus Knox' MySpace-Profil machen laut "Übermedien" damals die Runde: Knox hinter einem historischen Maschinengewehr, Knox mit Alkohol. Auch ihr Spitzname aus Schulzeiten – "Foxy Knoxy", übersetzbar mit "durchtriebenes Luder" – taucht in den Zeitungen auf. Einfach alles wird als Beweis für ihre angebliche teuflische Persönlichkeit gedeutet.
Fatale Falschaussage
Vor allem in einer Falschaussage wird ein Beleg für Knox‘ Durchtriebenheit gesehen: Unter Druck bezichtigt die 20-Jährige – die nur über rudimentäre Italienischkenntnisse verfügt – während eines 14 Stunden dauernden nächtlichen Verhörs fälschlicherweise den Barbesitzer Patrick L. des Mordes.
Am nächsten Tag widerruft sie ihre Aussage, L. hatte ein wasserdichtes Alibi und kommt nach wenigen Tagen aus der Untersuchungshaft frei – doch der Schaden war bereits angerichtet. Mit der falschen Beschuldigung schadet sich Knox schwer.
In ihrem Buch "Zeit, gehört zu werden" wird Knox laut "Süddeutscher Zeitung" später schreiben: "Ich war so verwirrt, dass ich mir im Kopf Bilder zurechtlegte, die mit dem von den Ermittlern erdachten Szenario, das sie mir eintrichterten, übereinstimmten. "
2019 – über 20 Jahre später – wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg anerkennen, dass Knox bei dieser Polizeibefragung massiv unter Druck gesetzt wurde. Sie hatte weder einen angemessenen Rechtsbeistand noch einen professionellen Übersetzer an ihrer Seite. Knox wird eine Entschädigung in Höhe von rund 18.000 Euro zugesprochen, zu zahlen vom italienischen Staat.
Knox wird in erster Instanz schuldig befunden
Am 4. Dezember 2009 fällt das erste Urteil: Knox wird wegen Mordes zu 26 Jahren Haft verurteilt, Sollecito zu 25 Jahren. Das Schwurgericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden gemeinsam mit dem Drogen-Kriminellen G. Meredith Kercher ermordet haben. Doch gegen das harte Urteil regt sich Protest.
Knox' Familie startet eine Kampagne für ihre Freilassung. Zwei Jahre später, am 3. Oktober 2011, kippt ein Berufungsgericht in Perugia das Urteil und spricht Knox und Sollecito frei. Die Begründung: gravierende Ermittlungsmängel. Das angebliche Tatmotiv – ein okkultes Sex-Spiel zwischen vier Personen – sei pure Spekulation ohne jede Grundlage.
Knox bricht laut "Zeit" in Tränen aus, als das Urteil verkündet wird. Nach vier Jahren im Gefängnis ist sie wieder frei. Sie kehrt zurück in ihre Heimat, die USA – doch die Saga war damit noch nicht zu Ende.
Justiz pendelt zwischen Schuld und Unschuld
Anders als in Deutschland kennt die italienische Justiz den Rechtsgrundsatz "Ne bis in idem" nicht – die Regel, dass niemand zweimal für dasselbe Verbrechen angeklagt werden darf. Der Kassationshof, Italiens höchstes Gericht, hebt 2013 den Freispruch für Knox und Sollecito auf und ordnet eine neue Verhandlung an.
Das Gericht in Florenz folgt daraufhin wieder der Theorie vom gemeinsamen Mord: Am 30. Januar 2014 werden Knox und Sollecito erneut verurteilt – diesmal in Abwesenheit. Knox zu 28 Jahren und sechs Monaten, Sollecito zu 25 Jahren.
Knox verfolgt den Prozess und das Urteil aus den USA. "Ich kehre niemals freiwillig nach Italien zurück", erklärt sie laut "Spiegel" damals. Dass die USA eine Staatsbürgerin an Italien ausliefern würde, ist unwahrscheinlich. Doch auch wenn sie in den USA der Haftstrafe entgeht: Sie gilt wieder als verurteilte Mörderin.
Finales Urteil: Knox ist unschuldig
2015 setzt der italienische Kassationshof den finalen Schlusspunkt in diesem Justizdrama. In letzter Instanz werden Knox und Sollecito endgültig freigesprochen. Die Begründung ist laut "Spiegel" vernichtend: Es gebe keinerlei Beweise für eine Beteiligung der beiden an der Tat – und kein glaubhaftes Motiv. Rudy G. habe allein gehandelt.
Der Mordfall Kercher war demnach kein kompliziertes Verbrechen mit mehreren Tätern und okkulten Motiven. Rudy G., ein Einbrecher, überrascht die junge Frau allein in ihrer Wohnung, vergewaltigt sie und tötet sie wohl, als sie Widerstand leistet.
Weiterer Prozess wegen Falschaussage
Für die Falschaussage gegen den Barbesitzer Patrick L. musste sich Knox 2024 allerdings noch einmal vor Gericht verantworten. Laut einem Bericht in der "TAZ" wurde sie dafür zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Die Strafe wurde ihr jedoch erlassen – schliesslich hatte sie wegen des Moders bereits vier Jahre unschuldig hinter Gittern verbracht.
Der Mordfall an Meredith Kercher offenbart die Schwächen des italienischen Rechtssystems. Staatsanwälte, die ihre Theorien mit aller Macht durchsetzen wollen und eine Presse, die Sensationen über Fakten stellt, führten zu einem jahrelangen Pingpong zwischen den Instanzen.
Vor allem aber zeigt der Fall, wie schnell aus einer normalen jungen Frau ein Monster konstruiert werden kann. Knox wurde vor allem zum Opfer von Vorurteilen: Sie war eine Ausländerin – und entsprach nicht dem Klischee einer "anständigen" jungen Frau.
Empfehlungen der Redaktion
Der verurteilte Täter, Rudy G., kam 2021 nach 13 Jahren Haft wegen guter Führung vorzeitig frei. Knox lebt heute mit ihrem Mann Christopher Robinson und ihren zwei Kindern in der Nähe von Seattle. Sie arbeitet als Podcasterin und engagiert sich für Justizopfer.
Rechtlich ist sie unschuldig, aber das Stigma bleibt. Der Titel "Engel mit den Eisaugen" – die perfide Erfindung der Boulevardpresse – lebt in vielen Köpfen weiter.
Verwendete Quellen:
- Welt.de: "Mysteriöser Mord: Der Fall Meredith Kercher und Amanda Knox"
- Stern.de: "Der ewige Albtraum der Amanda Knox"
- Sueddeutsche.de: "Mord an Meredith Kercher: Die Verwandlung der Amanda Knox"
- Übermedien.de: "Geiler Journalismus, fast wie Sex"
- Zeit.de: "Sexualmord von Perugia: Freispruch für Amanda Knox"
- Spiegel.de: "Amanda Knox: "Ich kehre niemals freiwillig nach Italien zurück""
- Spiegel.de: "Freispruch für Amanda Knox: Wer ist nun der Mörder?"
- TAZ.de: "Verleumdungsprozess in Italien: Amanda Knox erneut verurteilt"