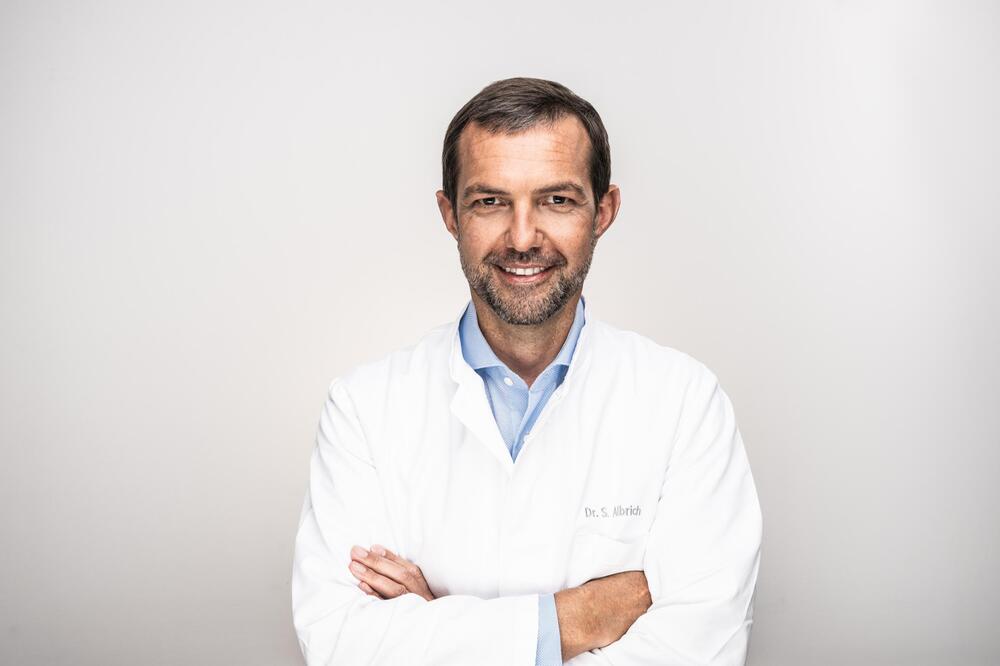Viele Menschen urinieren falsch – oft ohne es zu wissen. Gängige, aber ungesunde Praktiken können auf lange Sicht gesundheitliche Folgen haben. Worauf vor allem Frauen beim Wasserlassen achten sollten – ein Urogynäkologe klärt auf.
Was kann man beim kurzen Stopp auf der Toilette schon falsch machen? Vor allem bei Müttern muss es oft schnell gehen: Zeit, um sogar allein auf die Toilette gehen zu können, ist knapp, also tendieren Frauen oft dazu, sich zu beeilen, zu drücken oder zu pressen – oder den Urin zurückzuhalten.
Auch das vorsorgliche Entleeren der Blase oder das Wasserlassen abzubrechen sind Verhaltensweisen, die auf lange Sicht gesundheitliche Folgen haben und sich negativ auf den Beckenboden auswirken können.
Stefan Albrich ist Gynäkologe und auf Urogynäkologie spezialisiert. Im Interview spricht er darüber, wie Frauen idealerweise ihre Blase entleeren sollten, wie entscheidend ein gestärkter Beckenboden für die Lebensqualität ist – und warum er sich dafür einsetzt, dass Frauen in der Medizin nicht nur als Mütter angesehen werden.
Herr Albrich, wie geht man als Frau "richtig" auf die Toilette?
Stefan Albrich: Als Tipp würde ich sagen, dass Frauen sich vor allem Zeit lassen und sich entspannen sollten, und nur dann auf Toilette gehen, wenn sie wirklich einen wesentlichen Drang verspüren – nicht prophylaktisch.
Klingt ganz einfach.
Im Grunde ist das ein ganz natürlicher Vorgang, den wir im Laufe unseres Lebens lernen und den auch im Allgemeinen fast alle Menschen gut beherrschen. Solange keine Probleme bestehen, denken wir auch gar nicht darüber nach und alles geht seinen natürlichen, koordinierten Gang.
Wie läuft dieser Vorgang denn im Normalfall ab?
Die Blase ist ein Organ, das eine Speicherfunktion und eine Entleerungsfunktion hat. Der normale Ablauf ist so, dass sich in der ersten Phase der Speicherung die Blase kontinuierlich füllt, nicht nur in Abhängigkeit von der Trinkmenge, sondern es werden auch laufend die Nieren durchblutet, und die Nieren fördern ebenfalls eine kontinuierliche Füllung der Blase. Die Blase hat die Eigenschaft, dass sie sich dehnen kann, und erst ab einer deutlichen Füllung kommt es dann über Druckrezeptoren in der Blase tatsächlich zu dem Signal: Die Blase ist voll.
Und dann setzt die Entleerungsfunktion ein?
Das Signal wird von der Blase über das Rückenmark an das Gehirn geschickt, kommt im Blasenentleerungszentrum an und sorgt dann dafür, dass wir uns auf den Weg zur Toilette machen. Das ist alles mit einem gewissen Zeitpuffer verbunden, sodass wir im Allgemeinen ausreichend Zeit haben, eine Toilette aufzusuchen. Die Blasenentleerung erfolgt nach Entspannung des Schliessmuskels und Anspannung des Blasenwandmuskels.
Richtig auf die Toilette gehen – das gilt es zu beachten
Gibt es an diesem Punkt nun ein "Richtig" oder "Falsch", was den Toilettengang angeht?
Es gibt ein paar Angewohnheiten, die man sich falsch angewöhnen kann: Dazu gehört, dass die Frauen zum Beispiel unter Druck Wasser lassen, mit der Bauchpresse die Blase mit Gewalt entleeren wollen oder auch, dass die Patientin prophylaktisch die Blase so häufig entleert, dass sie sich eine kleine Blase antrainiert. Das können Verhaltensmassnahmen sein, die problematisch sind.
Woran kann ich erkennen, dass mit der Blase etwas nicht stimmt?
Die Häufigkeit der Blasenentleerung ist sehr individuell. Manche Frauen müssen häufiger auf Toilette, bei anderen passt eher viel in die Blase. Das heisst, wir haben im Schnitt etwa eine Blasenfüllung von 300 bis 600 Milliliter. Als Faustregel lässt sich feststellen: Wenn eine Frau untertags etwa acht- bis zehnmal und nachts ein- bis zweimal auf die Toilette geht, ist das normal. Wenn es deutlich über zehnmal pro Tag oder dreimal pro Nacht sind, könnte dies ein Hinweis auf Blasenprobleme sein. Und wenn die Frau ungewollt Urin verliert, spricht man von Inkontinenz, sodass sie einen Arzt aufsuchen sollte.
Spürt man als Frau auch körperliche Symptome oder Beschwerden, zum Beispiel Schmerzen?
Schmerzen in der Blase sind, abgesehen von akuten Blasenentzündungen, eher eine Seltenheit. Aber es gibt gelegentlich chronische Entzündungen der Blase, die sogenannte Interstitielle Zystitis, oder Blasensteine, die ebenfalls Schmerzen verursachen können. Im Allgemeinen bleibt eine Harninkontinenz schmerzlos.
Tabuthema Blasenschwäche
Für viele Frauen sind Blasenschwäche oder Inkontinenz Tabuthemen – dabei sind sehr viele Frauen über ein breites Altersspektrum hinweg davon betroffen.
Die Inkontinenz der Frau ist ein sehr häufiges Problem, das Frauen aller Altersgruppen betrifft. Selbst junge, sportliche Frauen berichten schon von Harninkontinenz. Wir wissen aus Studien, dass sogar Spitzensportlerinnen von ungewolltem Urinverlust betroffen sind und sehr häufig Inkontinenz-Einlagen verwenden.
Und welche Risikogruppen gibt es konkret?
Zahlreiche Lebensphasen der Frau wie Schwangerschaften, Geburten, operative Eingriffe, Bestrahlungen und hormonelle Veränderungen beeinflussen den Beckenboden und belasten die Blasenfunktion.
Was können Frauen tun, die Probleme bei sich bemerken?
Sehr häufig bemerken die Frauen schon bei alltäglichen Situationen wie Treppensteigen oder normaler sportlicher Aktivität, dass sie Urin verlieren. Eine Harninkontinenz in der Schwangerschaft kann ein Frühzeichen sein. In der Folge kann Hilfe bei Ärztinnen oder Physiotherapeutinnen gesucht oder schon ein Beckenbodentraining begonnen werden.
Der Beckenboden hat welche Funktion im Zusammenhang mit der Blase?
Der Blasenschliessmuskel ist Teil des komplexen Systems des Beckenbodens. Der Beckenboden schliesst den Körper nach unten hin ab und hat dort Bindegewebe und verschiedene Muskeln, die sowohl die Organe halten als auch die Blase und den Darm. Im Laufe der Zeit kann unsere Muskulatur schwächer werden und die Schliessmuskelfunktionen nachlassen. Bei der Frau gibt es dort durch die Anatomie, durch die kurze Harnröhre, eine gewisse natürliche Schwachstelle: Wir wissen, dass der Beckenbodenmuskel sich bei einer vaginalen Geburt um das Dreifache dehnt, weshalb gerade bei Frauen nach vaginalen Geburten das Risiko für Harnkontinenz oder Beckenbodenschwäche deutlich erhöht ist.
Gezieltes Beckenbodentraining als Lösung?
Sollte gezieltes Beckenbodentraining also für jede Frau ein Thema sein?
Frauen sollten, und das praktiziere ich in meinem ärztlichen Alltag so, von den Frauenärztinnen und Frauenärzten aktiv auf dieses Thema hingewiesen und beraten werden. Bereits vor der ersten Schwangerschaft oder auch bei einer Tastuntersuchung frage ich die Patientinnen, ob sie den Beckenboden gut anspannen können – denn nicht jede Frau kann den Beckenboden problemlos ansteuern.
Wenn ich betroffen bin – was mache ich dann?
Erste Schritte zu einem gesunden Beckenboden sollten Anpassungen des Verhaltens sein – eine ausreichende Trinkmenge, Reduktion von koffeinhaltigen Getränken, körperliche Aktivität und eine Gewichtsoptimierung, aber auch eine Anpassung vorhandener Medikamente.
Optimierung von Verhaltensmassnahmen können bereits Probleme am Beckenboden deutlich verbessern, sodass Operationen vermieden werden können. Regelmässige körperliche Aktivität trägt zur Beckenbodengesundheit bei. Besonders geeignet sind Yoga- und Pilates-Übungen, welche die Körpermitte stärken und so den Beckenboden aktivieren können.
Warum ist das Thema so tabuisiert?
Kein Mensch spricht gerne über Harninkontinenz, wenn er selbst betroffen ist. Aber leider ist es auch so, dass sogar in der Pflege und selbst im ärztlichen Bereich viele dieses Thema meiden. Es wird dann gerne abgetan, die Frauen werden vertröstet, dass das schon wieder wird oder dass solche Symptome in gewisser Weise normal seien. Aber die Blasenfunktion und die Kontinenz sind ein hoher Wert für die Lebensqualität von Frauen. Es gibt diesen Spruch: "Die Inkontinenz bringt einen nicht um, aber sie nimmt dir das Leben."
Empfehlungen der Redaktion
Gerade in der intensiven Schwangerenbetreuung haben wir in den vergangenen Jahrzehnten so viel erreicht – eine massive Verringerung der Kindersterblichkeit und die Verbesserung der Gesundheit von Säuglingen. Aber ich finde, jetzt ist es wirklich Zeit, auch mal die Lebensqualität von Frauen und Müttern, also auch die Beckenbodengesundheit, in den Fokus zu nehmen: Es geht nicht nur um die Mama, sondern auch um die Frau! Neben der Blasenfunktion muss an dieser Stelle aber auch auf die Sexualität als weitere wichtige Aufgabe des Beckenbodens hingewiesen werden.
Welche Barrieren könnte man nach abbauen, um die Aufklärung voranzutreiben und das Tabuthema aus der schambehafteten Ecke zu holen?
Dies ist der entscheidende Punkt und das liegt mir besonders am Herzen: Wir dürfen uns nicht vor diesem Thema drücken. Wir müssen das Thema wirklich enttabuisieren und den Frauen die Angst nehmen. Es ist kein seltenes Problem. Jede fünfte Frau leidet nicht nur darunter, sondern wird – in Industriestaaten – aufgrund einer Inkontinenz oder einer Beckenbodensenkung sogar operiert. Obwohl wir so eine offene, aufgeklärte Gesellschaft sind, ist Inkontinenz weiter ein Tabu – und das, obwohl in Deutschland heutzutage mehr Windeln für Erwachsene verkauft werden als für Kinder.
Über den Gesprächspartner
- PD Dr. Stefan Albrich ist Frauenarzt mit Schwerpunkt Beckenboden. Neben seiner Tätigkeit in der eigenen Praxis leitet er als Oberarzt die Urogynäkologie an der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde des TUM Klinikums Rechts der Isar.