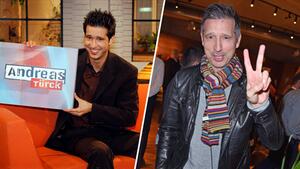Am Sonntag startet die 15. Staffel von "Schwiegertochter gesucht". Der Medienpsychologe Benjamin P. Lange erklärt im Interview mit unserer Redaktion, warum die RTL-Kuppelshow immer noch erfolgreich ist, wer sich "Schwiegertochter gesucht" anschaut und was Trash-TV mit menschlichen Grundbedürfnissen zu tun hat.
Benjamin P. Lange, am 10. März startet die 15. Staffel von "Schwiegertochter gesucht" auf RTL, die Sendung läuft seit 2007. Überrascht es Sie, dass das Format derart langlebig ist?
Benjamin P. Lange: Nicht wirklich. Das Format ist ja mittlerweile schon Kult. Die Gestaltungsmerkmale der Sendung sind so, dass "Schwiegertochter gesucht" durchaus dauerhaft funktioniert. Das Interesse an der Sendung ist da. Das Format befriedigt Bedürfnisse, die manche Menschen haben – die wir vom Grundprinzip her alle haben. Und zwar von Natur aus. Deshalb ist es eigentlich gar nicht so überraschend, dass die Sendung schon so lange läuft.
Warum schauen sich Menschen ein Format wie "Schwiegertochter gesucht" an?
In der Sozial-, aber auch der Medienpsychologie gibt es die Theorie des abwärts gerichteten sozialen Vergleichs. Was bedeutet das konkret für das besagte TV-Format? Man bekommt im Fernsehen jemanden präsentiert, der das Gleiche will wie man selbst. Eine Partnerschaft und Beziehungen, glücklich und zufrieden sein. Aber man bekommt Leute präsentiert, die von der sozialen Stellung her tendenziell unter einem selbst stehen. Leute, über die man sich vielleicht auch ein bisschen lustig machen und auf die man herabblicken kann. Man vergleicht sein Leben mit dem dieser Kandidatinnen und Kandidaten und fühlt sich automatisch besser. Man ist attraktiver, man ist begehrter, man hat den besseren Job – was bei diesen Kandidatinnen und Kandidaten keine Kunst ist. Das Ganze firmiert eben unter diesem Begriff des abwärts gerichteten sozialen Vergleichs.
Besser fühlen durch Trash-TV
Also spielt das Gefühl der Überlegenheit bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eine entscheidende Rolle?
Das kann man so sagen. Sich überlegen, sich besser zu fühlen, das macht etwas mit dem Selbstwert. Wenn ich sehe, dass es den Kandidatinnen und Kandidaten viel schlechter geht als mir selbst, dass sie unattraktiver sind und schlechtere Jobs haben, fühle ich mich besser. Das ist auch ein Stück weit Voyeurismus. Wenn ich zuschaue, wie sie sich abstrampeln, geht es mir besser.
Wir leben in krisenhaften Zeiten. Trägt das dazu bei, dass sich Menschen nach leichter Unterhaltung sehnen?
Vielleicht. In Zeiten, in denen es wirtschaftlich nicht so gut läuft, haben die Menschen auch Angst vor einem sozialen Abstieg und Jobverlust. Das Leben wird allgemein rauer, da kann ein Rückzug ins Private, wo man sich selbst aufwertet, indem man "Schwiegertochter gesucht" schaut, helfen. "Bauer sucht Frau" funktioniert ja nach dem gleichen Prinzip. Genauso wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", nur dass dabei die Kandidatinnen und Kandidaten mal prominent waren. Alles, was mir in Zeiten einer empfundenen Krise hilft, mich besser zu fühlen, ist eine gute Idee.
"Niemand ist stolz darauf, 'Schwiegertochter gesucht' zu schauen"
In einem Ihrer Texte wird Trash-TV als "Guilty Pleasure" beschrieben. Also als etwas, das man gerne tut, wobei man sich aber auch schuldig fühlt.
Wenn ich mir eine fette Pizza liefern lasse und "Schwiegertochter gesucht" schaue, wäre das sogar ein "Guilty Pleasure" im Doppelpack. Wahrscheinlich ist niemand so richtig stolz darauf, "Schwiegertochter gesucht" zu schauen – oder ständig fette Pizza zu essen. Aber man macht es trotzdem. Das ist genauso, wie wenn man sich einen halben Liter Eiscreme reinstopft. Dann fühlt man sich ein bisschen besser, das Dopamin steigt. Das bringt ein bisschen Freude, ein bisschen Ablenkung. Wenn man nach einem schlechten Tag nach Hause kommt, ist das Balsam für die Seele. Da geht es nicht um Vernunft, sondern um Emotionen und darum, diese zu regulieren. Ich fühle mich nicht so gut, also konsumiere ich jetzt ein bisschen Medien. Vieles passiert aus einem Impuls heraus. Wie wenn man auf Diät ist, aber dann doch eine ganze Tüte Gummibärchen isst.
Eine Online-Umfrage des Max-Planck-Instituts Frankfurt hat ergeben, dass Trash-TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer überdurchschnittlich gebildet sind. Wer schaut sich Ihrer Meinung nach Trash-TV an?
Das Klischee wäre, dass eher Menschen Trash-TV schauen, die eine niedrigere Bildung haben. Grundsätzlich gilt: Alle Menschen, die Medien nutzen, haben unbewusste Erwartungen, was ein Medium befriedigen soll. Ob es Information ist oder Emotionsregulation. Es ist schon denkbar, dass ein solches Format, das ordentliche Quoten hat, von ganz unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlicher Bildung und aus unterschiedlichen Motiven angeschaut wird.
Man könnte aber auch sagen, dass für Menschen mit niedriger Bildung der abwärts gerichtete soziale Vergleich gar nicht so möglich ist, weil die Fallhöhe nicht gegeben ist. Der eher gut gebildete Mensch findet überhaupt erst diesen Unterschied im sozialen Status vor, um diesen abwärts gerichteten sozialen Vergleich vornehmen zu können. Dadurch wird ein solches Ergebnis wie aus der Online-Umfrage recht gut erklärbar.
Eine letzte Idee: Der Hochgebildete macht ja sowieso den ganzen Tag schon Dinge, die seiner Bildung entsprechen – im Job zum Beispiel. Dann hat man sich am Abend dann auch mal eine Auszeit von der Hochkultur verdient.
Gezeigt bekommen, was alles nach unten möglich wäre
Eines ihrer Spezialgebiete ist Partnerwahl und Partnerschaft. Wie beurteilen Sie aus diesem Blickwinkel Kuppelshows wie "Schwiegertochter gesucht" oder "Bauer sucht Frau"?
Zunächst mal ist es eine gute Idee, solche Shows zu machen. Denn: Wir haben fast alle den Wunsch, in einer Beziehung zu sein und beim von uns bevorzugten Geschlecht gut anzukommen. Das ist für niemanden etwas Fremdes. Wer sich solche Shows anschaut, kann sofort verstehen, was dort passiert. Wir alle haben auch intuitiv eine Vorstellung davon, was physische, aber auch soziale Attraktivität ausmacht. Dann checken wir die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihre Attraktivität ab. Und schütteln teilweise den Kopf, womit wir wieder bei dem abwärts gerichteten sozialen Vergleich wären.
Wie realistisch ist das Gezeigte?
Es wird sehr viel mit Partnerwahlmechanismen gespielt. Früher war da die Kult-Kandidatin Beate, um die sich die Männer gerissen haben. Unter normalen Gesichtspunkten der Partnerwahl wäre Beate allerdings nicht sonderlich begehrt. In der Sendung ist sie aber begehrt, weil sie in ein Setting mit Männern gebracht wird, die ansonsten ebenfalls wenig Chancen auf dem Partnermarkt hätten. Und dann wetteifern diese Männer um sie. Als Partnerwahl-Psychologe würde man sagen, dass man hier in einem Segment unterwegs ist, wo die Chancen unter normalen Bedingungen sehr niedrig sind. Jetzt bringt man diese Frauen und Männer zusammen und generiert eine Dynamik, die so auf dem normalen Partnermarkt nicht oder kaum stattfindet.
Hat es Einfluss auf die eigene Partnerwahl und Partnerschaft, wenn man sich solche Formate anschaut?
Wir wissen aus der Forschung, dass man unzufriedener mit der eigenen Beziehung ist, wenn man sich übermässig attraktive Menschen anschaut. Daraus würde ich spontan die These ableiten, dass man mit der eigenen Beziehung eher zufriedener ist, wenn man sich Trash-Formate mit eher unattraktiven Menschen anschaut. Denn man bekommt gezeigt, was alles nach unten möglich wäre, und ist dann froh.
Vorhin haben Sie bereits die Kult-Kandidatin Beate erwähnt. Sie und einige andere Kandidatinnen und Kandidaten sind mittlerweile zu Memes geworden, kurze Ausschnitte werden als Reels in ständiger Wiederholung in den sozialen Medien gepostet. Warum schauen sich Menschen diese Memes und Reels immer wieder an?
Wenn man ein solches Meme verwendet, zeigt man, dass man dazugehört, sich auskennt und nicht hinter dem Mond lebt. Dieses Dazugehören ist ein Teil des Phänomens, das war auch bei "Deutschland sucht den Superstar" oder "Big Brother" so, als diese Sendungen neu waren. Ein anderer Punkt ist die Vertrautheit, die uns wichtig ist, um uns gut und sicher zu fühlen. Wenn uns so ein Meme bekannt ist, entsteht ein Gefühl von Vertrautheit, von Zugehörigkeit. Wir fühlen uns nicht so alleine. Stichwort "alleine": Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig Klatsch und Tratsch für den Menschen sind. Sich mit anderen auf gut Deutsch das Maul zu zerreissen über die Kandidaten, ist also auch ein wichtiger Aspekt.
Empfehlungen der Redaktion
Und es gibt immer auch die Möglichkeit, dass uns diese Memes zum Lachen bringen. Weil wir sie amüsant finden, oft aber auch wegen des Peinlichkeitsfaktors. Das holt uns vielleicht auch für einen Moment aus dem Alltag heraus, wenn wir so etwas auf dem Handy sehen.
Und wir haben bei diesem ganzen Phänomen das, was wir parasoziale Beziehung nennen. Wenn wir sehr viel "Schwiegertochter gesucht" konsumieren, sagt uns unser emotionales System, dass wir Beate kennen, dass sie unsere Freundin oder zumindest eine gute Bekannte ist. Das funktioniert ähnlich mit "Tagesschau"- Sprechern oder Influencerinnen. Ab einem gewissen Punkt gaukelt uns unser emotionales System vor, diese Leute zu kennen, obwohl es natürlich nicht so ist. Wenn ich dann Beate sehe, ist das, wie wenn ich eine Bekannte auf der Strasse treffe. Dann freue ich mich.
Über den Experten:
- Prof. Dr. habil. Benjamin P. Lange ist Professor für Psychologie an der IU International University of Applied Sciences in Berlin. Seine Schwerpunkte liegen u. a. in den Bereichen Sprach-, Kommunikations- und Medienpsychologie sowie Psychologie der Partnerwahl. Er arbeitet nebenberuflich in eigener Praxis als Heilpraktiker für Psychotherapie sowie als psychologischer Berater, Mediator und Paartherapeut.
Verwendete Quellen:
- Mediendiskurs.online: "Ich sehe was, was du nicht sehen würdest - und das habe ich mir auch verdient"
- zeitjung.de: "Trash-TV-Zuschauer*innen sind überdurchschnittlich gebildet"