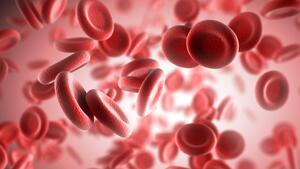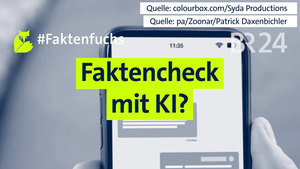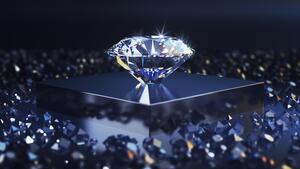Mit der Verabschiedung von Gert Scobel in den Ruhestand übernehmen zwei Frauen das Zepter beim 3sat-Wissenschaftsformat, das ab sofort nicht mehr "Scobel", sondern "NANO Talk" heisst: Medizinethikerin Alena Buyx und Journalistin Stephanie Rohde diskutieren seit dem 28. August immer donnerstags um 21 Uhr mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen. Im Interview spricht Alena Buyx unter anderem über die Rolle von KI in der Medizin und Fragen, die uns alle etwas angehen, wenn es um Leben und Sterben geht.
In der Regel sind Sie in verschiedenen TV-Formaten zu Gast – nun moderieren Sie im Wechsel mit der Journalistin Stephanie Rohde den "NANO Talk" bei 3sat. Wie fühlt es sich an, dieses neue berufliche Terrain zu betreten und nicht mehr Gast, sondern Gastgeberin zu sein?
Was ist für Sie das Besondere an diesem Format?
Ich finde es super, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk und insbesondere 3sat als Kultur- und Wissenschaftssender neu sortiert haben und einen verstärkten Fokus darauf legen, Wissenschaft ins Fernsehen zu bringen. Es geht darum, die Begeisterung für Wissenschaft einem möglichst breiten Publikum nahezubringen. Es gibt, national wie international betrachtet, nicht viele TV-Formate, die sich unaufgeregt und mit viel Zeit wissenschaftlich komplexen Fragen widmen. Gleichzeitig gibt es durchaus ein Bedürfnis, auch mal in die Tiefe zu gehen und das möchten wir abholen.
Wen konkret möchten Sie mit der Sendung erreichen?
Das offensichtliche Publikum der Sendung ist am ehesten ein bildungsbürgerliches Publikum mit Interesse an wissenschaftlichen Fragen. Ich finde es wichtig, dem weiter eine Heimat zu bieten. Gleichzeitig findet eine Verzahnung der Sendung mit einem YouTube-Format statt. Bedeutet: Elemente der Sendung finden sich in verkürzter Form auf der Plattform. Indem wir für "NANO Talk" kleine Veränderungen hinsichtlich der Gästeauswahl vornehmen, erhoffe ich mir, vielleicht auch Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen, die bislang möglicherweise mit Wissenschaftsformaten weniger zu tun hatten. Ich bilde mir aber nicht ein, dass die Sendung plötzlich ein breites Massenpublikum ansprechen wird. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns auf den Weg machen, viele Menschen zu erreichen, weil ich ein klares Anliegen habe.
Welches Anliegen wäre das?
Ich möchte die Menschen für Wissenschaft begeistern. Keine Frage, Wissenschaft ist wahnsinnig kompliziert. Insofern ist es nachvollziehbar, dass viele Menschen Berührungsängste mit ihr haben. Gleichzeitig sind wir in der Wissenschaft auf nicht immer perfekt darin, in die Gesellschaft zu kommunizieren. Hinzu kommt das zunehmende Phänomen, dass, wie ich finde, zu viele Menschen der Wissenschaft nicht mehr trauen, sondern alternativen Quellen von Information Gehör schenken. Dieser Vertrauensverlust ist weniger ein Verlust als eine Verschiebung von Vertrauen in Richtung von teils wilden Verschwörungstheorien.
Diese Verschiebung ist weltweit zu beobachten und ich empfinde sie als alarmierend. Denn die wissenschaftliche Methode ist letztlich die Grundlage all unseres Fortschritts. Umso wichtiger ist es mir, den Menschen mitzugeben, wie toll Wissenschaft ist und dass sie grossen Spass bereiten kann. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Menschen, mit denen man sich entspannt auf jeder Grillparty zu ihren Themen unterhalten und mit denen man super produktiv streiten kann. Ausserdem bietet Wissenschaft nicht nur Probleme, sondern vor allem Lösungen.
Ihre erste Folge widmet sich dem Thema "Das Wesen der KI" – wie ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Medizin aus medizinethischer Sicht zu bewerten?
Ohne KI wird es in der Medizin auf Dauer nicht gehen. Wir leben in einem Gesundheitswesen mit Fachkräftemangel, steigendem Versorgungsbedarf und demografischem Wandel – insofern sind wir darauf angewiesen, dass Künstliche Intelligenz jenen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ein Stück weit den Rücken freihält und sie unterstützt. Insbesondere würde ich mir ganz viel KI-Unterstützung bei Verwaltungsarbeit im Gesundheitswesen wünschen. Aber warum nicht auch in der Diagnostik oder in Form eines Assistenzsystems in der Therapie?
KI birgt aber auch Risiken, was bedeutet, ihren Einsatz verantwortlich zu gestalten. Bezüglich des Gesundheitsbereichs mache ich mir mit Blick auf den Einsatz von KI aber ehrlicherweise nur wenig Sorgen, denn wir sind es gewohnt, neue und durchaus risikobehaftete Technologien in die Medizin einziehen zu lassen. Der Einsatz von KI hat ein enormes Potenzial – gleichzeitig wird der medizinische Bereich sorgfältig überwacht, sodass auf Risiken und ethische Folgen und Gefahren ein hohes Augenmerk gelegt wird. Mit Blick auf KI in der Medizin bin ich also ziemlich optimistisch gestimmt.
In diesem Jahr ist Ihr Buch "Leben & Sterben" erschienen – ein Buch für die existenziellen Fragen im Leben, die uns alle etwas angehen. Worum geht es?
Mir war es wichtig, die Themen des Buches nicht abstrakt, sondern anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen. Ich möchte zeigen, wie wichtig Antworten auf Fragen wie "Wie möchte ich leben?" oder "Wie selbstbestimmt bin ich?" für jeden sind. Die Kernfrage des Buches lautet "Wie treffe ich gute Entscheidungen?" – eine Frage, die weit über die Themen Gesundheit, Krankheit, Sterben und Tod hinausgeht. In dem Buch nehme ich die Leserinnen und Leser mit in meinen Fokusbereich des Lebensanfangs bis hin zum Lebensende. Dabei ist die Bandbreite enorm: Es geht um Fortpflanzungsmedizin, aber eben auch wieder um KI in der Medizin. Ich gebe dabei hoffentlich ethisches Werkzeug an die Hand, mit dem man sehr praxisnah auch herausfordernde ethische Fragen leichter und besser entscheiden kann.
Von 2020 bis 2024 waren Sie Vorsitzende des Ethikrats. Wie ist es Ihnen gelungen, dieses Ehrenamt mit Ihrem eigentlichen Beruf zu vereinbaren?
Es war eine sehr besondere Zeit, die in weiten Teilen während der Pandemie stattfand. Viele Menschen sind während der Pandemie weit über das normale Mass hinausgegangen und auch wir hatten als Gremium eine intensive Zeit. Ich hatte das grosse Glück, dass die Technische Universität München meiner ehrenamtlichen Tätigkeit mit grosser Wertschätzung begegnet ist. Dennoch habe ich mich während der gesamten Zeit nie vertreten lassen, sondern das Institut weiterentwickelt, worauf ich sehr stolz bin. Ich hatte aber die Möglichkeit, etwas weniger zu lehren und durfte zudem etwas weniger in der sogenannten Selbstverwaltung arbeiten.
Ich bin ein Mensch, der gerne 150 Prozent arbeitet. Die Anerkennung der Universität hat es mir dann ermöglicht, nur noch 100 Prozent arbeiten zu müssen (lacht). Mit Blick auf meine Familie kann ich sagen, dass wir sehr gut darin sind, uns in intensiven Phasen zu unterstützen. Hinzu kommt die Tatsache, dass ich den Vorsitz des Ethikrats aus tiefster Überzeugung übernommen habe: Ich wollte immer mit meiner wissenschaftlichen Arbeit gesellschaftlich etwas beitragen. Dieses Amt übernehmen zu dürfen, war das grosse Privileg meines beruflichen Lebens.
Über die Gesprächspartnerin
- Prof. Dr. Alena Buyx ist ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Buyx studierte Medizin, Philosophie, Soziologie und Gesundheitswissenschaften. Als Professorin für Medizinethik ist sie Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Technischen Universität München.