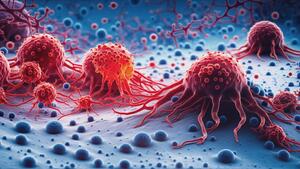Ein neues Medikament soll gegen fortgeschrittenen Gebärmutterhalskrebs helfen. Wie wirkt es und welche Risiken gibt es bei dieser "Chemotherapie der nächsten Generation"?
Die Firma Biontech plant, in den USA noch in diesem Jahr einen Zulassungsantrag für ein Medikament zur Behandlung von fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs zu stellen.
Biontech ist bisher hauptsächlich wegen seines im Dezember 2020 zugelassenen mRNA-Impfstoffs zum Schutz vor Covid-19, "Comirnaty", bekannt. Dabei ist der eigentliche Schwerpunkt der Firmengründer Ugur Sahin und Özlem Türeci seit Langem die Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs, zum Beispiel mit Hilfe von mRNA-Impfstoffen oder Antikörpern. Das Unternehmen hat zahlreiche Wirkstoffe in der Pipeline, viele davon befinden sich bereits in klinischen Studien.
Lesen Sie auch
Mit BNT323/DB-1303 soll jetzt der Sprung auf den pharmazeutischen Markt gelingen. Wegen überzeugender Studienergebnisse hatte das Medikament von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA Ende 2023 den "Breakthrough-Therapy-Status" erhalten: "Mit dem Status und der Unterstützung der FDA wollen wir das Tempo in der Entwicklung von BNT323/DB1303 weiter erhöhen", sagte Özlem Türeci damals in einer Pressemitteilung.
Die Auszeichnung des Medikamentes durch die FDA unterstreiche das grosse Potenzial dieses Technologieansatzes und die hohe medizinische Relevanz, insbesondere bei schwer behandelbaren Erkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs, sagt Christian Hackenberger vom Leibniz Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie in Berlin (FMP) und Mitgründer der Firma Tubulis GmbH, die selbst Therapeutika gegen Krebs entwickelt: "Jeder Fortschritt in diesem Bereich stärkt das gesamte Feld, eröffnet neue Perspektiven für die Krebstherapie und bringt sie für alle Beteiligten weiter voran."
Wie wirkt das neue Medikament?
BNT323 gehört zur Gruppe der "Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" (englisch: Antibody Drug Conjugates, ADC), die Krebszellen zielgerichtet vernichten sollen. Diese Medikamente bestehen in der Regel aus drei Komponenten:
- einem Antikörper, der ein Molekül erkennt, das die Krebszellen auf ihrer Oberfläche tragen;
- einem Wirkstoff, der die Krebszellen abtöten soll, und
- einem molekularen "Linker", der Antikörper und Wirkstoff miteinander verbindet.
BNT323 ist eine Kombination des Antikörpers Trastuzumab und des Chemotherapeutikums Pamirtecan. Ersterer reagiert mit dem Wachstumsfaktor-Rezeptor HER2, den verschiedene Krebszellen tragen, zum Beispiel solche der Brust, des Magens und der Gebärmutter. Pamirtecan ist ein sogenannter Topoisomerase-1-Hemmstoff. Er blockiert ein Enzym, das für die Zellteilung wichtig ist.
Ergebnisse einer klinischen Phase1/2-Studie hatte Biontech bereits vor zwei Jahren präsentiert. Es zeigte sich laut Pressemitteilung "eine ermutigende Anti-Tumor-Aktivität in stark vorbehandelten Patientinnen mit fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs". Knapp 60 Prozent der Patientinnen sprachen auf die Behandlung an, die Krankheit stabilisierte sich bei über 90 Prozent dieser Frauen. Das Medikament sei gut verträglich "mit einem kontrollierbaren Sicherheitsprofil". Die Firma testet BNT323 in klinischen Studien auch zur Behandlung von verschiedenen anderen fortgeschrittenen Tumorerkrankungen, etwa der Brust, der Eierstöcke oder des Dickdarms.
Vor 25 Jahren: Erste Zulassung eines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats
Die Idee klingt logisch und Forschende verfolgen sie schon seit über 40 Jahren: Statt den ganzen Organismus mit chemotherapeutischen Medikamenten und den bekannten Nebenwirkungen zu belasten, sollen die Zytostatika in Verknüpfung mit den Antikörpern möglichst keine gesunden Körperzellen abtöten, sondern gezielt nur die sich ungebremst vermehrenden Krebszellen.
Bereits im Jahr 1983 gelang der Nachweis, dass es im Prinzip möglich ist, einen Wirkstoff mithilfe eines Antikörpers direkt an eine Krebszelle heranzubringen. Vor genau 25 Jahren wurde ein erstes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) von der FDA zur Behandlung einer Leukämie-Form zugelassen. Seither sind die ADCs weiter entwickelt und verbessert worden – und mehr als ein Dutzend verschiedene weltweit zugelassen (Stand: 2022).
"Antikörper-Wirkstoff-Konjugate zählen zu den spannendsten und vielversprechendsten Fortschritten der modernen Krebstherapie."
Anfang der 2010er-Jahre kamen in Europa ADCs der zweiten Generation auf den Markt. Darunter zum Beispiel T-DM1 (Trastuzumab-Emtansin) zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs. ADCs der dritten Generation, wie etwa BNT-323, enthalten "humanisierte" Antikörperkomponenten, die im Gegensatz zu älteren Produkten den menschlichen Antikörpern sehr stark ähneln. Dadurch sollen sich unerwünschte Reaktionen bei der Behandlung weiter verringern.
"Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) zählen zu den spannendsten und vielversprechendsten Fortschritten der modernen Krebstherapie", sagt Christian Hackenberger. Ihr grosser Vorteil läge darin, dass sie die gezielte Wirkung von Antikörpern mit der Wirksamkeit klassischer Chemotherapie kombinieren. "Der Antikörper erkennt gezielt ein Tumormerkmal, wie zum Beispiel HER2, transportiert den daran gekoppelten Wirkstoff, auch Payload genannt, direkt in die Krebszelle und setzt ihn erst dort frei." Dadurch würden gesunde Zellen weitgehend geschont und Nebenwirkungen verringert, die Tumorzellen dagegen effizient bekämpft.
Welche Risiken und Herausforderungen gibt es?
Die Idee ist gut, doch auch für die Antikörper-Wirkstoff-Konjugate gibt es zahlreiche Hindernisse zu überwinden. Eines davon ist, die Zellen eines Tumors überhaupt erst einmal zu erreichen. In den Anfängen der ADC-Forschung konzentrierte man sich daher auf die wesentlich besser zugänglichen Formen von Blutkrebs. Bei soliden Tumoren konnten im Durchschnitt zunächst überhaupt nur rund zwei Prozent des verabreichten ADC-Medikaments in die Mikroumgebung des Tumors vordringen.
Auch die Toxizität und damit das Risiko für Nebenwirkungen bleiben eine grosse Herausforderung für die ADCs. Wie die Erfahrungen mit den Medikamenten zeigen, gibt es zwar eine gezieltere Wirkung. Dennoch werden häufig auch gesunde Körperzellen geschädigt, weil das Chemotherapeutikum auch sie erreicht. Eine Ursache dafür ist, dass der "Linker" instabil ist und seine Fracht bereits vor Erreichen des Tumors freigibt.
Oder die ADCs verbinden sich mit Blutproteinen wie dem Albumin, das sie huckepack auch in gesunde Körpergewebe hineinträgt. Häufige Nebenwirkungen der ADC-Therapie sind etwa verbunden mit Schädigungen von Blutzellen, wodurch es zu einem Verlust an Blutplättchen oder roten Blutkörperchen kommen kann.
Auch vor einem anderen Problem der Krebsmedizin sind die neuen Medikamente nicht gefeit: Die Tumorzellen können infolge der Behandlung resistent gegen das Medikament werden: Sie mutieren, verlieren das vom Antikörper anvisierte Molekül auf ihrer Oberfläche oder sie schrauben ihre sogenannte "Endozytose"-Rate herunter: Das heisst, sie nehmen die ADCs einfach nicht mehr in ihr Inneres auf, wodurch das Medikament nicht zur Wirkung kommen kann. Insgesamt scheinen die Nebenwirkungen im Vergleich zu klassischen Chemotherapien aber besser kontrollierbar zu sein.
Dennoch zeige das Gesamtbild, dass die Vorteile der ADC-Technologie, wie etwa die gezielte Wirkung, der Einsatz hochpotenter Wirkstoffe und die Schonung gesunder Zellen, in vielen Fällen die Risiken überwiegen, sagt Christian Hackenberger: "Dies gilt insbesondere für Patientinnen und Patienten, deren Tumore auf andere Therapien nicht mehr ansprechen."
Fortschritte der Präzisionsmedizin
Die aus einzelnen Modulen aufgebauten ADCs ermöglichen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten. Durch Variationen konnten Forschende in den letzten Jahren zwar die Wirksamkeit verbessern und Nebenwirkungen verringern. Und: "ADCs sind ein Paradebeispiel für den Fortschritt in der Präzisionsonkologie", so Hackenberger.
Doch der entscheidende Faktor bei allem ist: Was bringt das tatsächlich für die betroffenen Patientinnen und Patienten? Daten der DESTINY-Breast03-Studie beispielsweise vergleichen die Effekte von T-DM1, einem ADC der zweiten Generation, und T-DXd, einem ADC der dritten Generation, auf die Therapie von fortgeschrittenem, metastasierendem Brustkrebs: Unter der Behandlung mit T-DXd waren nach zwölf Monaten noch knapp 76 Prozent der Patientinnen am Leben, ohne dass die Krankheit fortgeschritten war, bei T-DM1 waren es gut 34 Prozent. Nach drei Jahren lag das Verhältnis bei knapp 46 Prozent zu gut zwölf Prozent.
"Mit der höheren Effektivität kam es aber auch zu mehr Nebenwirkungen im Vergleich zu T-DM1", schreibt das Deutsche Ärzteblatt. Dazu zählten neben Übelkeit und Erbrechen auch entzündliche Veränderungen der Lunge, Fatigue und Haarverlust.
Es geht auch um viel Geld
Ein Grund für die aktuelle Ankündigung von Biontech, bald ein neues Krebsmedikament auf den Markt bringen zu wollen, steht wohl auch in Zusammenhang mit der aktuellen finanziellen Situation: Im Jahr 2024 machte das Unternehmen laut dem "Manager Magazin" einen Verlust von 700 Millionen Euro. Die Ursache: Hohe Investitionen in die klinische Forschung auf der einen, abflauende Geschäfte mit dem Corona-Impfstoff auf der anderen Seite.
Bis 2030 soll sich die Mainzer Firma, wenn es nach Finanzvorstand Jens Holstein geht, zu einem führenden Biotech-Unternehmen mit mehreren onkologischen Produkten entwickeln. Dabei geht es auch um viel Geld: T-DXd etwa (Trastuzumab-Deruxtecan) etwa wird, wenn die Analysten recht behalten, im Jahr 2032 mit knapp zehn Milliarden US-Dollar das umsatzstärkste Arzneimittel bei Brustkrebs sein.
Über RiffReporter
- Dieser Beitrag stammt vom Journalismusportal RiffReporter.
- Auf riffreporter.de berichten rund 100 unabhängige JournalistInnen gemeinsam zu Aktuellem und Hintergründen. Die RiffReporter wurden für ihr Angebot mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.
Verwendete Quellen
- Süddeutsche Zeitung: Biontech peilt ersten Krebs-Zulassungsantrag Ende 2025 an
- Biontech: BioNTech und DualityBio erhalten Breakthrough-Therapy-Status der FDA für ADC-Kandidaten BNT323/DB-1303 zur Behandlung von Gebärmutterkrebs
- ScienceDirect: Benefits and challenges of antibody drug conjugates as novel form of chemotherapy
- Biontech: BNT323/DB-1303
- Journal of Clinical Oncology: Safety and efficacy of DB-1303 in patients with advanced/metastatic solid tumors: A multicenter, open-label, first-in-human, phase 1/2a study
- Pharmaceutical Technology: Trastuzumab pamirtecan by BioNTech for Solid Tumor: Likelihood of Approval
- Journal Onkologie: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate: Modularität bietet viele Stellschrauben
- Arzneimittelzherapie.de: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate in
der Tumortherapie - Nature: Antibody drug conjugate: the "biological missile” for targeted cancer therapy
- MDPI: Opportunities and Challenges in Antibody–Drug Conjugates for Cancer Therapy: A New Era for Cancer Treatment
- The New England Journal of Medicine: Trastuzumab Deruxtecan versus Trastuzumab Emtansine for Breast Cancer
- Nature: Trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansine in HER2-positive metastatic breast cancer: long-term survival analysis of the DESTINY-Breast03 trial
- Deutsches Ärzteblatt: Antikörper-Wirkstoff-Konjugate der 3. Generation: Breite Wirkung im Tumor
- Manager Magazin: Biontech schreibt rote Zahlen und streicht Stellen
- Pharmazeutische Zeitung: Wirkstoffe auf der Zielgeraden
© RiffReporter