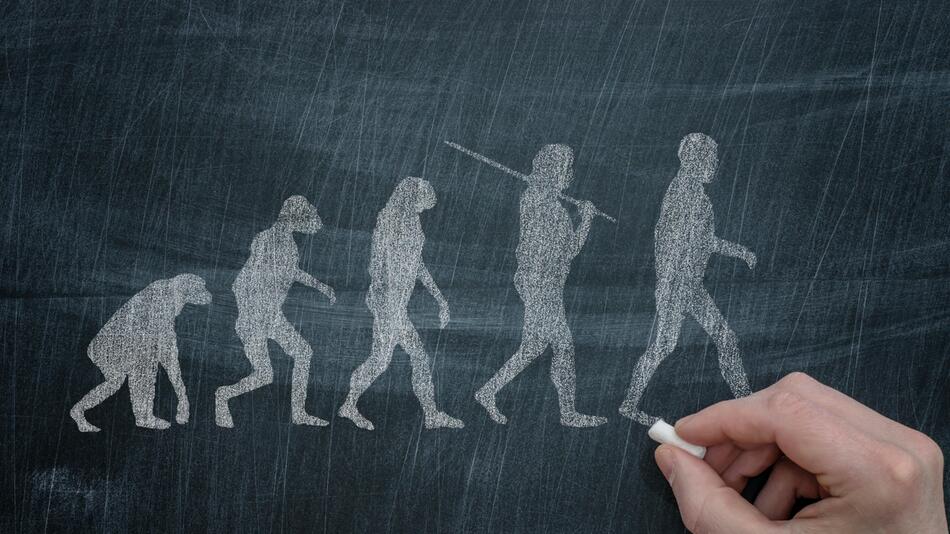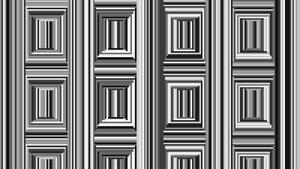Warum das Erfolgsrezept der frühen Homo sapiens auch heute noch relevant ist, wie Eschen durch Express-Evolution einen Pilz überleben und wie ein Enzym die häufigsten Erkrankungen stoppen könnte – drei gute News für eine gute Woche.
Die tägliche Flut an negativen Nachrichten lässt viele Menschen frustriert, traurig, wütend oder mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Trotzdem werden negative Schlagzeilen mehr gelesen als positive Meldungen – vermutlich aus einem evolutionsbiologischen Grund: Das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt, uns vor Gefahren zu bewahren. Deshalb reagiert es auf Schreckensmeldungen besonders sensibel und speichert negative Informationen stärker ab.
Aber: Doomscrolling, also gezielter und massiver Konsum von negativen Nachrichten, kann der psychischen Gesundheit schaden, wie zahlreiche Studien belegen. Positive Informationen wirken da wie ein Gegengewicht. Sie verdeutlichen, dass es auch konstruktive Lösungen für ein gutes Miteinander und eine bessere Zukunft gibt. In diesem Sinne: Hier sind drei gute Nachrichten.
Anpassung und Networking – eine menschliche Superpower damals und heute
Vor rund 70.000 Jahren begann der Homo sapiens, seinen Lebensraum in den unterschiedlichsten Regionen Afrikas auszuweiten und sich an die jeweiligen Lebensbedingungen anzupassen. Nach einigen gescheiterten Versuchen gelang unseren Vorfahren vor rund 50.000 Jahren die Wanderung nach Eurasien – und von dort aus in die ganze Welt.
Laut einer neuen Studie, an der Forschende des Max-Planck-Instituts beteiligt waren, trugen die Fähigkeit zur Anpassung an unterschiedliche afrikanische Lebensräume und der zunehmende Austausch mit anderen Gruppen dazu bei, dass der Homo sapiens ausserhalb Afrikas dauerhaft Fuss fassen konnte. Flexibilität und Kommunikation wurden zum Schlüssel für sein Überleben.
Auf das Erfolgsrezept unserer Vorfahren – sich vernetzen und flexibel bleiben – setzt heute auch die globale Initiative "Making Cities Resilient 2030" (MCR2030). Das Programm der UN und zahlreicher Partnerorganisationen will Städte weltweit miteinander verbinden und sie dabei unterstützen, widerstandsfähiger gegenüber aktuellen und künftigen Herausforderungen zu werden – damit sie und ihre Bewohner gesund wachsen können. Denn: Vor allem in Städten sind Belastungen wie Hitzewellen, Infektionsrisiken, traumatische Ereignisse wie Terroranschläge und psychosozialer Stress besonders spürbar.
Neben dem Zugang zu Fördermitteln und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützt das Programm Städte dabei, ihre eigenen Risikofaktoren zu identifizieren und stabile Strategien zu entwickeln – und regt dazu an, erfolgreiche Strategien mit anderen zu teilen. Austausch, Wissenstransfer und Vernetzung sind wichtige Aspekte des Programms. Zusammenarbeit statt Isolation.
Express-Evolution im Wald: Eschen entwickeln Resistenz gegen Pilze
Millionen Eschen in Europa sind vom Eschensterben betroffen – ausgelöst durch einen Pilz namens Hymenoscyphus fraxineus. In Grossbritannien könnten bis zu 85 Prozent der älteren Bäume verloren gehen. Doch es gibt Hoffnung: Eine aktuelle Studie der Royal Botanic Gardens Kew und der Queen-Mary-Universität London zeigt, dass junge Eschen erstaunlich schnell eine genetische Resistenz gegen den Pilz entwickelt haben – durch natürliche Selektion im Zeitraffer.
Auch interessant
Die Forschenden verglichen die DNA älterer Bäume mit der von jüngeren, die nach Auftreten des Pilzes gewachsen sind. Das Ergebnis: Die jungen Bäume überleben deutlich häufiger. Der Grund liegt im Erbgut, dort fanden sich feine, aber entscheidende Veränderungen an Tausenden Stellen. Der Pilz wirkt offenbar wie ein biologischer Filter: Nur die widerstandsfähigsten Pflanzen überstehen die ersten Jahre.
Die genetische Analyse der Eschen ist ein wissenschaftlicher Durchbruch: Sie liefert den ersten überzeugenden Beweis für die These von Charles Darwin, dass sich Organismen nicht nur durch ein oder zwei grosse Veränderungen stark anpassen können, sondern auch durch viele kleine – und das im Schnelldurchlauf. In nur einer Baumgeneration sind widerstandsfähigere Eschen entstanden, die Forschenden konnten der Evolution regelrecht zuschauen.
Noch sei die Rettung der Esche damit aber nicht gesichert. Die Studienautoren zeigen sich jedoch vorsichtig optimistisch: Mit gezielter Förderung und Raum für natürliche Erneuerung könnten sich die Wälder langfristig selbst helfen.
Enzym könnte das Entstehungsrisiko vieler Volkskrankheiten senken
Entzündungen spielen eine wichtige Rolle während der Immunreaktion. Sie helfen dem Körper bei der Heilung von Wunden oder bei Infektionen. Wird der normale Entzündungsprozess durch Faktoren wie anhaltenden Stress oder Verletzungen gestört, können Entzündungen aber die Zellen schädigen und wichtige Funktionen beeinträchtigen. Dadurch steigt das Risiko für die Entstehung von verschiedenen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Ein Forschungsteam der Universität von Texas hat jetzt einen krankheitsfördernden Mechanismus entdeckt – und wie man ihn aufhalten kann. Die Forschenden fanden heraus, dass das Enzym IDO1 während Entzündungsphasen aktiviert wird. Es produziert eine Substanz, die die Fähigkeit von Makrophagen – auch Fresszellen genannt – hemmt, überschüssiges Cholesterin aus dem Blut aufzunehmen und abzutransportieren. Dieser Vorgang kann langfristig zu gefährlichen Ablagerungen in den Blutgefässen und zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen entzündungsbedingten Krankheiten führen.
Doch es gibt offenbar eine Möglichkeit, diesen Mechanismus zu stoppen: Wird IDO1 gehemmt, nehmen die Immunzellen ihre Schutzfunktion wieder auf und beseitigen Cholesterinreste aus dem Blut. Ausserdem entdeckten die Forschenden ein weiteres Enzym namens NOS, das den Effekt von IDO1 verstärkt. Die Entdeckung der Enzyme ist deshalb so vielversprechend, weil sie zu neuen Behandlungsmöglichkeiten führen könnte, die nicht nur die Symptome lindern, sondern bei einer zentralen Ursache vieler Krankheiten ansetzen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Krebs gehören zu den häufigsten Todesursachen weltweit. Durch eine gesunde Lebensweise könnte das Risiko für ihre Entstehung in vielen Fällen gesenkt werden – oder sogar verhindert. Vielen Menschen fällt es jedoch selbst nach einer Diagnose schwer, gesunde Gewohnheiten dauerhaft umzusetzen. Der Grund dafür ist meistens nicht mangelnde Motivation oder fehlendes Wissen, häufig sind es tief verankerte Verhaltensmuster, die nur schwer abgelegt werden können. Umso bedeutender könnte das neue Wissen über die Enzyme sein.
Verwendete Quellen
- Nature: Major expansion in the human niche preceded out of Africa dispersal
- Max-Plank-Institut: Anpassung als Schlüssel: So gelang dem Menschen der Weg aus Afrika
- CR 2030: The strategic objectives of MCR2030
- Science: Rapid polygenic adaptation in a wild population of ash trees under a novel fungal epidemic
- UTA: Can enzyme behind high cholesterol be turned off?
- ACS Publications: HDLR-SR-BI Expression and Cholesterol Uptake are Regulated via Indoleamine-2,3-dioxygenase 1 in Macrophages under Inflammation