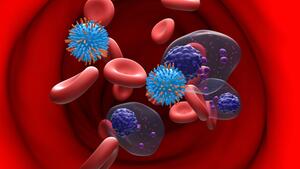Die wichtigste medizinische Forschungsbehörde in den USA fördert Forschung ohne Tierversuche, warum Grossstadtkinder ein Haustier haben sollten und Kuhmist wird zu klimafreundlichem Material – drei gute Nachrichten für die Woche.
Die tägliche Flut an negativen Nachrichten lässt viele frustriert, traurig, wütend oder mit einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Trotzdem werden negative Schlagzeilen mehr gelesen als positive Meldungen – vermutlich aus einem evolutionsbiologischen Grund: Das menschliche Gehirn ist darauf ausgelegt, uns vor Gefahren zu bewahren. Deshalb reagiert es auf Schreckensmeldungen besonders sensibel und speichert negative Informationen intensiver ab.
Aber: Doomscrolling, also gezielter und massiver Konsum von negativen Nachrichten, kann der psychischen Gesundheit schaden. Das belegen zahlreiche Studien. Positive Informationen wirken da wie ein willkommenes Gegengewicht. Sie verdeutlichen, dass es auch konstruktive Lösungen für ein gutes Miteinander und eine bessere Zukunft gibt. In diesem Sinne: Hier sind die guten Nachrichten des Monats.
Mehr Forschung ohne Tierversuche in den USA
Der Grossteil aller Wirkstoffe, die in Tierversuchen erfolgreich waren, scheitern später in klinischen Studien am Menschen und schaffen es nicht bis zur Marktzulassung. Das liegt unter anderem daran, weil sich Ergebnisse aus Tierversuchen nicht immer auf den Menschen übertragen lassen. Dabei verstreicht viel Zeit, es fallen hohe Kosten an und es entsteht oft unnötiges Tierleid.
Als ethisch gelten hingegen sogenannte menschenbasierte Testmethoden, die oft relevanter für uns sind. Auch wenn es danach klingt – Menschen müssen dafür nicht herhalten. Moderne Methoden wie diese machen das überflüssig:
- Organoide: Mini-Organe aus menschlichen Stammzellen, die die Funktionen echter Organe nachahmen.
- Organ-on-a-Chip: Kleine Chips mit menschlichem Gewebe, die Blutfluss, Atmung oder Stoffwechsel simulieren.
- In-vitro-Tests: Labortests mit Zellkulturen aus Haut, Leber oder Lunge, mit denen Wirkstoffe oder Toxizität direkt am Menschengewebe geprüft werden.
In den USA wurde der Paradigmenwechsel in der biomedizinischen Forschung nun offiziell eingeläutet. Ende April gab die wichtigste medizinische Forschungsbehörde National Institutes of Health (NIH) bekannt, menschenbasierte Forschungstechnologien zukünftig zu priorisieren und deren Entwicklung zu fördern. Dadurch soll die biomedizinische Forschung ethischer werden und näher am Menschen stattfinden.
NIH-Direktor Dr. Jay Bhattacharya erklärte, die Initiative markiere den Beginn einer neuen Ära der Innovation: Fortschritte in Datenwissenschaft und Technologie kombiniert mit dem wachsenden Verständnis der menschlichen Biologie könnten die Forschung grundlegend verändern – von der Entwicklung bis zur Anwendung.
Auch in der EU wird die Entwicklung von menschenbasierten Technologien wie "menschlichen Zwillingen" gefördert. Diese digitalen Modelle einzelner Patientinnen und Patienten können individuelle Reaktionen auf Therapien oder Medikamente vorhersagen – ohne Nebenwirkungen für Mensch oder Tier.
Lesen Sie auch
Studie belegt positive Wirkung von Haustieren auf Grossstadtkinder
Viele Eltern kennen es: Das Kind wünscht sich nichts sehnlicher als ein Haustier. Eine neue Studie der Uniklinik Ulm, an der auch Wissenschaftler aus den USA beteiligt waren, liefert jetzt ein gutes Argument für Hund, Katze und Co. – und entkräftet das elterliche Argument, dass ein Tier nichts in der Stadt verloren habe. Denn: Grossstadtkinder, die mit einem Haustier aufwachsen, scheinen im Erwachsenenalter weniger anfällig für stressbedingte Störungen zu sein.
Für die Studie wurden 40 gesunde Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren, die in der Stadt entweder mit oder ohne Hund oder Katze aufgewachsen waren, einem wissenschaftlich standardisierten Stresstest unterzogen.
Vor und nach dem Test wurden den Studienteilnehmern Blut- und Speichelproben entnommen, um relevante Werte wie Entzündungsparameter oder den Stresshormonspiegel zu messen. Ausserdem wurde die Herzfrequenz sowie ihre Variabilität vor, während und nach dem Test aufgezeichnet.
Was bedeutet Variabilität?
- Variabilität kommt vom lateinischen Wort variabilis und bedeutet veränderlich. Es wird meistens im umfassenden Sinne verwendet, sowohl im eigentlichen Wortsinn als Veränderlichkeit, aber auch für die mehr oder minder grosse Verschiedenheit in der Ausprägung der Eigenschaften bei den Individuen einer Art. Das wird spektrum.de zufolge differenzierend auch als Variation bezeichnet.
Das Ergebnis: Teilnehmer ohne Tierkontakt in der Kindheit zeigten unter Stress eine schnellere Aktivierung bestimmter Abwehrzellen und stärkere entzündliche Reaktionen als jene, die mit einem Haustier aufgewachsen waren. Offenbar stärkt der Kontakt zu Haustieren das Immunsystem und die Darmbarriere, wodurch übermässige Entzündungsreaktionen bei akutem oder wiederholtem Stress besser abgefangen werden.
Während Kinder gesundheitlich von Haustieren profitieren, freuen sich viele Tiere in den Tierheimen über ein liebevolles Zuhause. Fazit: Ein Ja zum Haustier tut beiden Seiten gut.
Klimafreundliche Cellulose aus dem Kuhstall
Die Kuh hat es nicht leicht. Im täglichen Sprachgebrauch muss sie als Sinnbild für zahlreiche Abwertungen herhalten. Als wäre das nicht genug, ist sie auch als Klimasünderin bekannt – Methan in der Luft, Nitrat im Grundwasser. Eine klimafreundliche Entwicklung könnte dazu beitragen, die Kuh zu rehabilitieren. Aus ihren Hinterlassenschaften lässt sich zwar kein Gold machen, aber ein wichtiges und vielseitig verwendbares Material.
Ein Forschungsteam des University College London (UCL) hat eine besonders energiesparende Methode entwickelt, mit der aus Kuhmist Nanocellulose gewonnen werden kann. Cellulose wird beispielsweise für die Herstellung von Textilien, Medikamenten, Verpackungen und als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Aus der besonders feinen Nanocellulose können wichtige Medizinprodukte wie Wundauflagen oder Gesichtsmasken nachhaltig hergestellt werden.
Empfehlungen der Redaktion
Eigentlich wird Cellulose aus Pflanzenresten gewonnen, vor allem aus Holz und Baumwolle, aber auch aus recyceltem Altpapier. Die Herstellung erfordert allerdings viel Energie, Wasser, Chemikalien und Fläche. Der Vorteil von Cellulose aus dem Kuhstall: Solange Kuhmilchprodukte und Fleisch als zentrale Nahrungsquellen dienen, sind Kuhfladen als Abfallprodukt massenhaft vorhanden – und könnten nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft sinnvoll genutzt werden. So wird aus dem Mist von gestern ein Rohstoff von morgen.
Verwendete Quellen
- National Institute of Health: NIH to prioritize human-based research technologies
- Europäische Kommission: European Virtual Human Twins Initiative
- Science Direct: Pawsitive impact: How pet contact ameliorates adult inflammatory stress responses in individuals raised in an urban environment
- Universität Ulm: Die positive Wirkung von Pfoten
- Science Direct: Harnessing cow manure waste for nanocellulose extraction and sustainable small-structure manufacturing